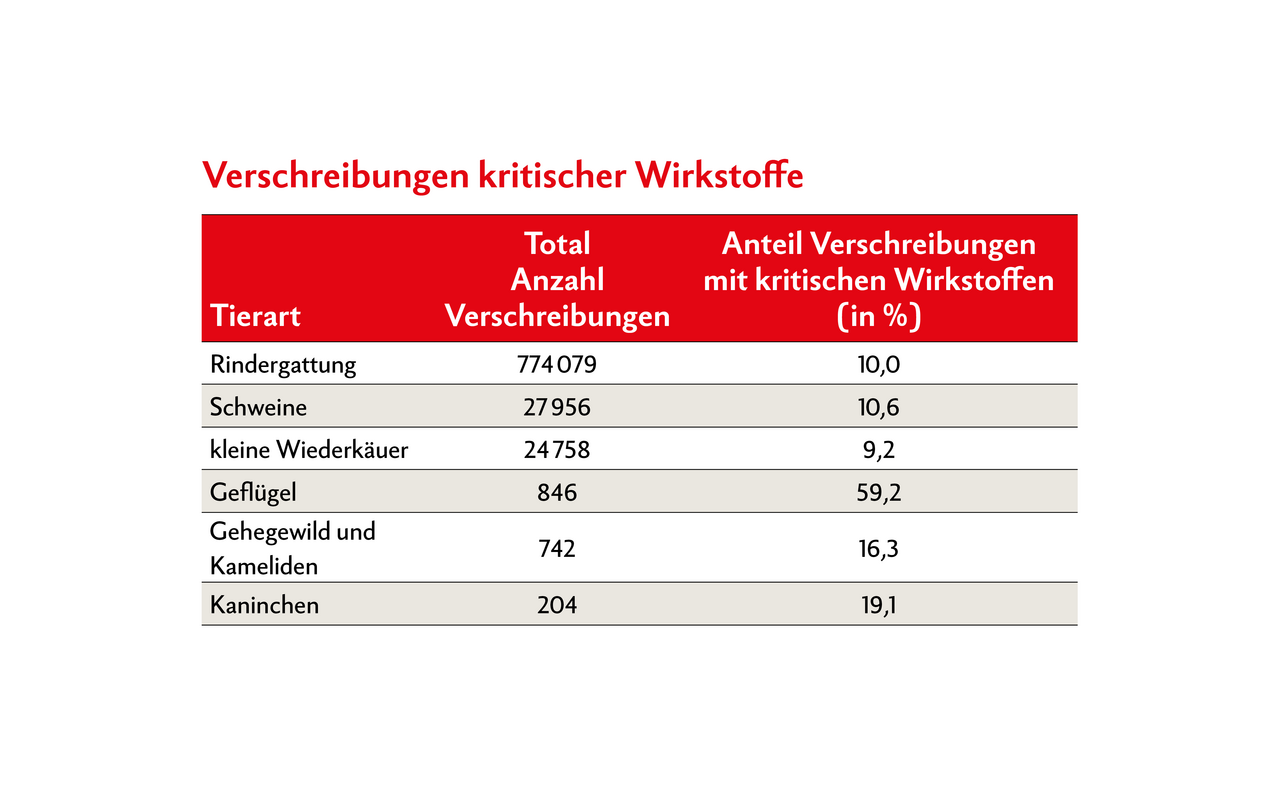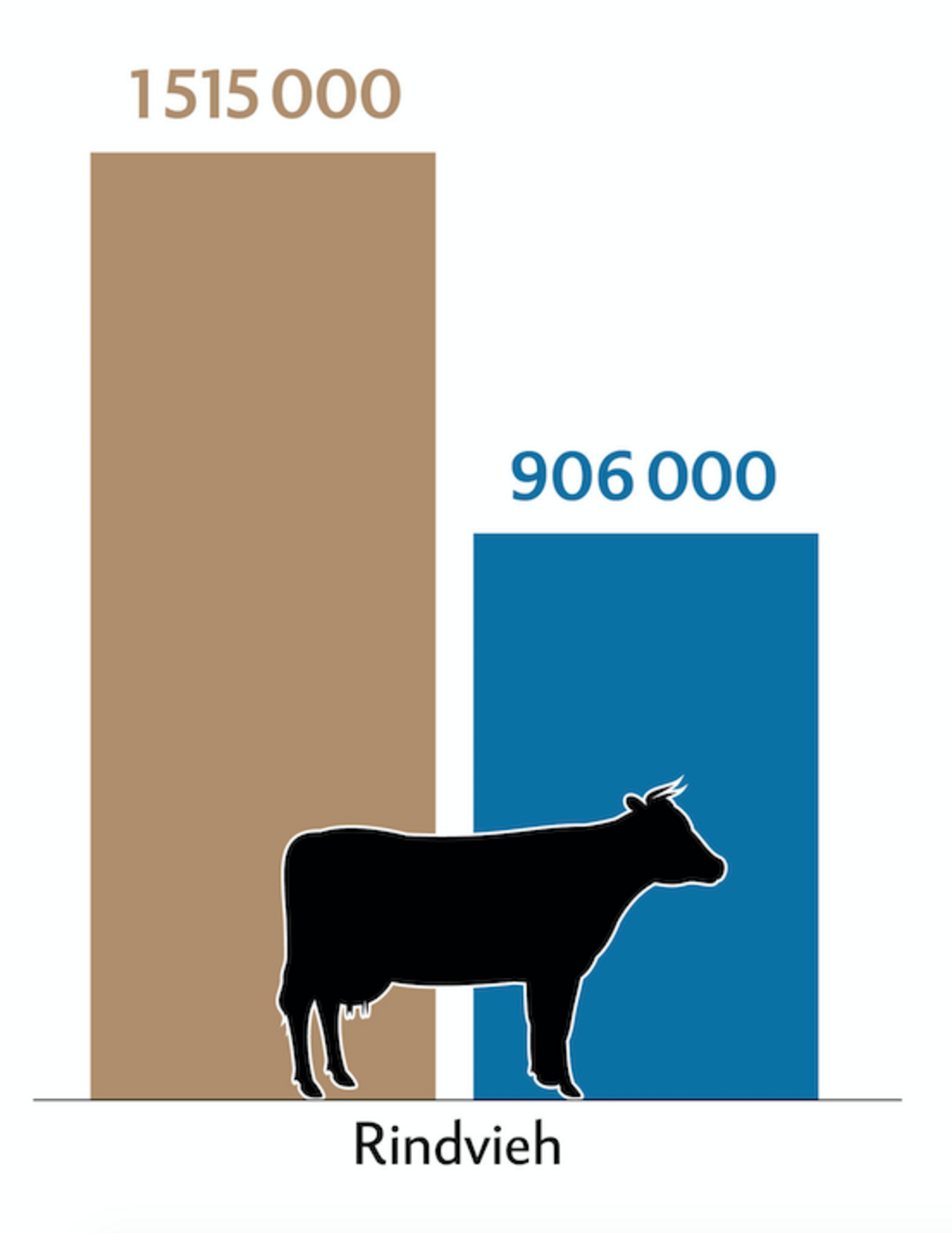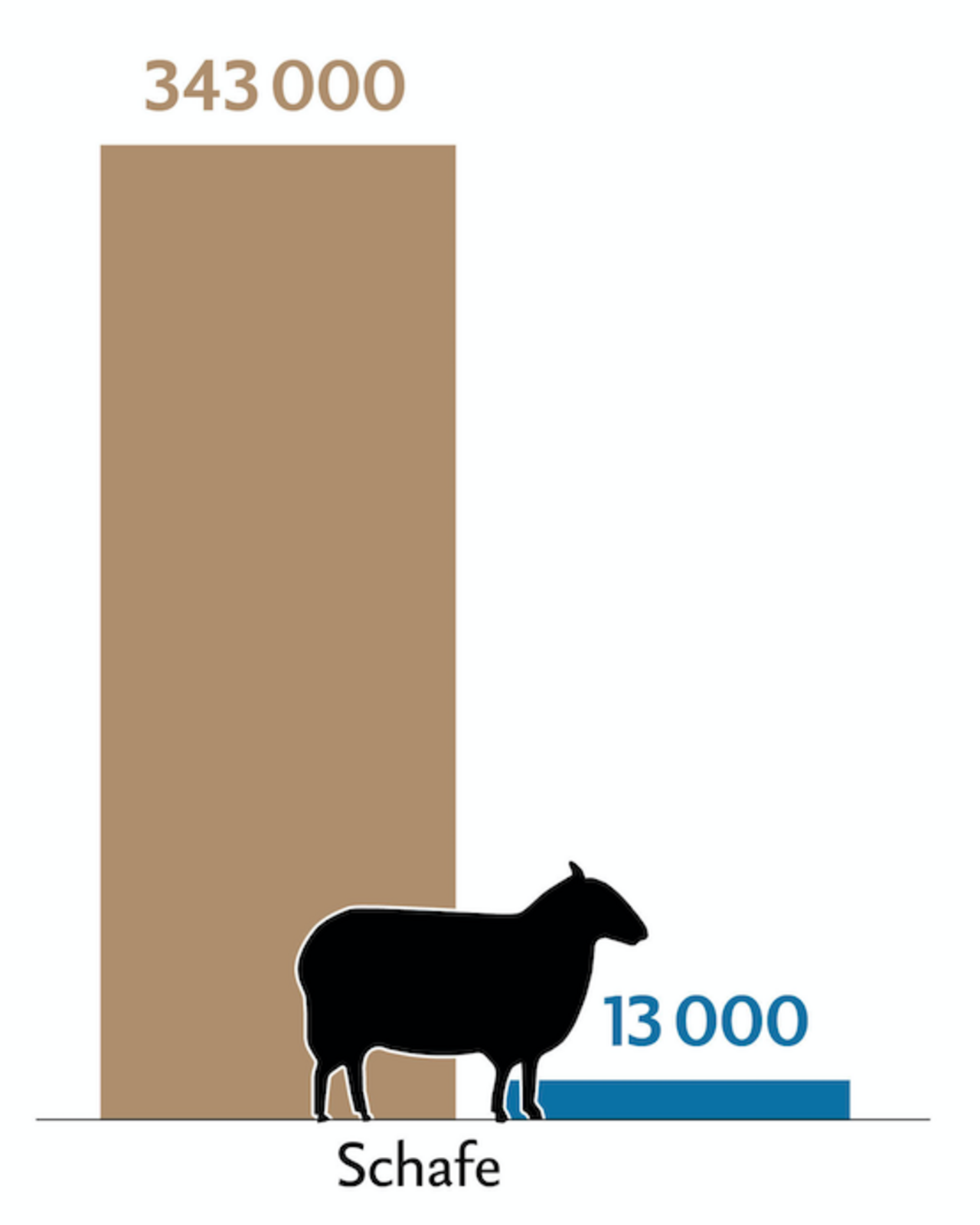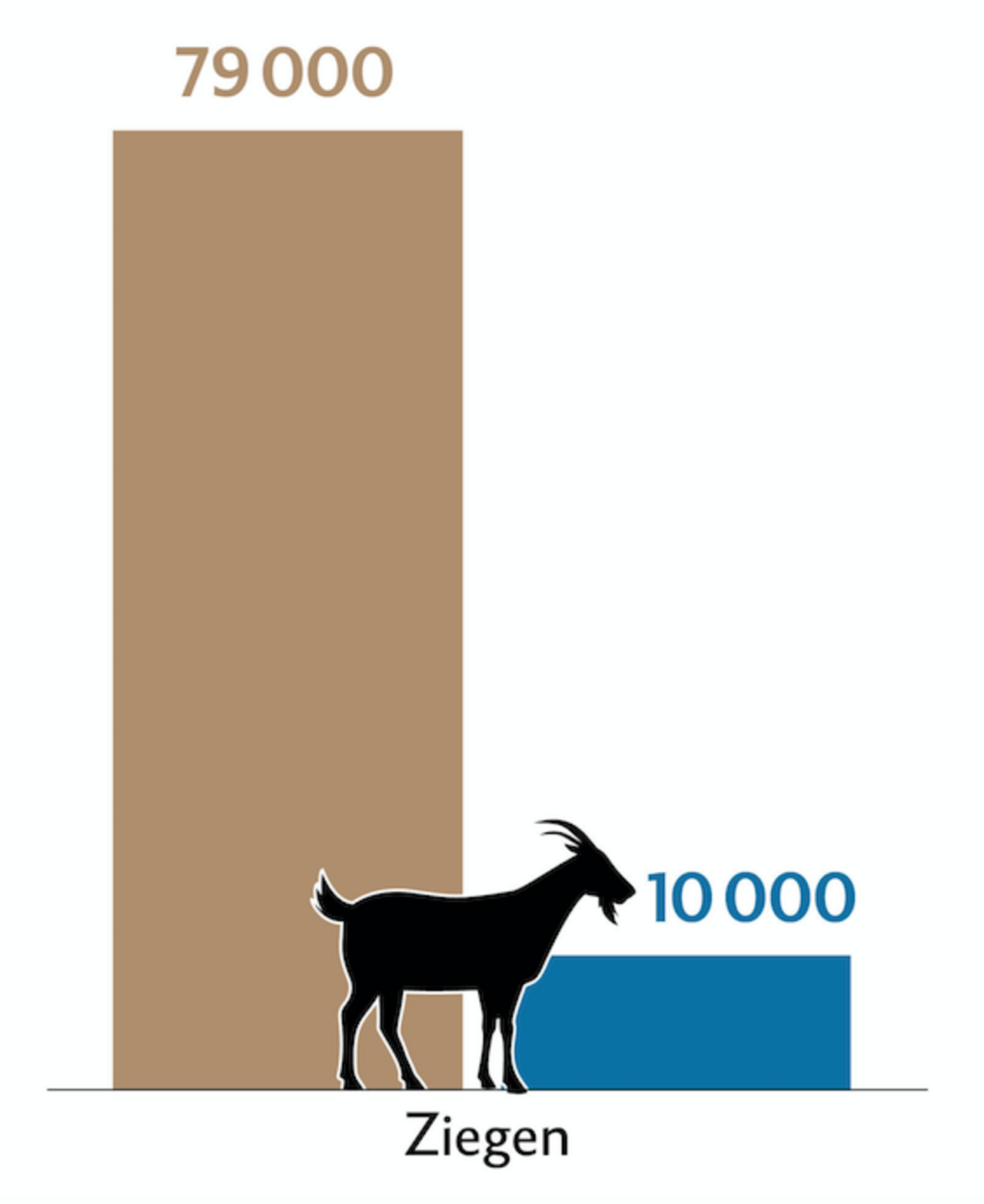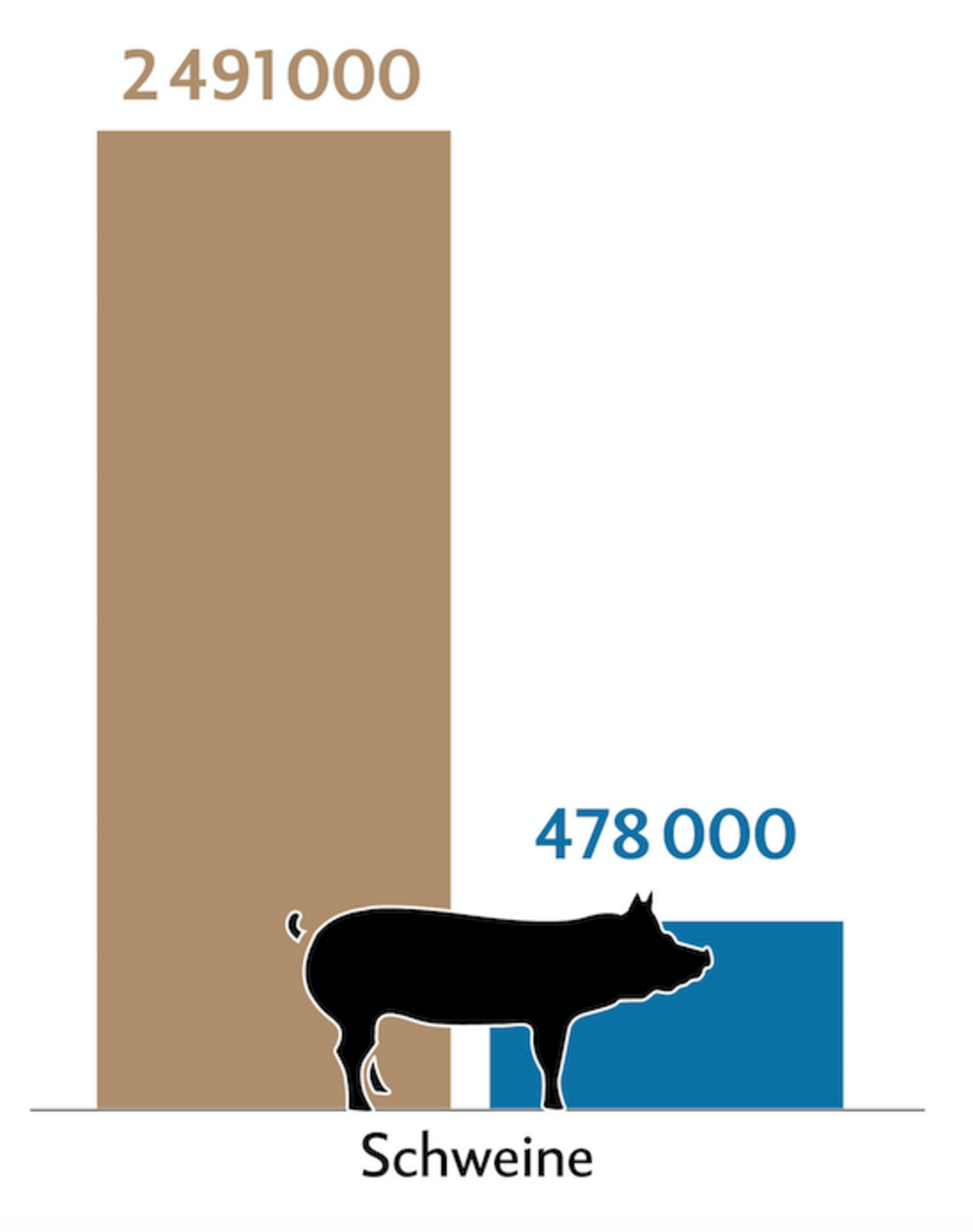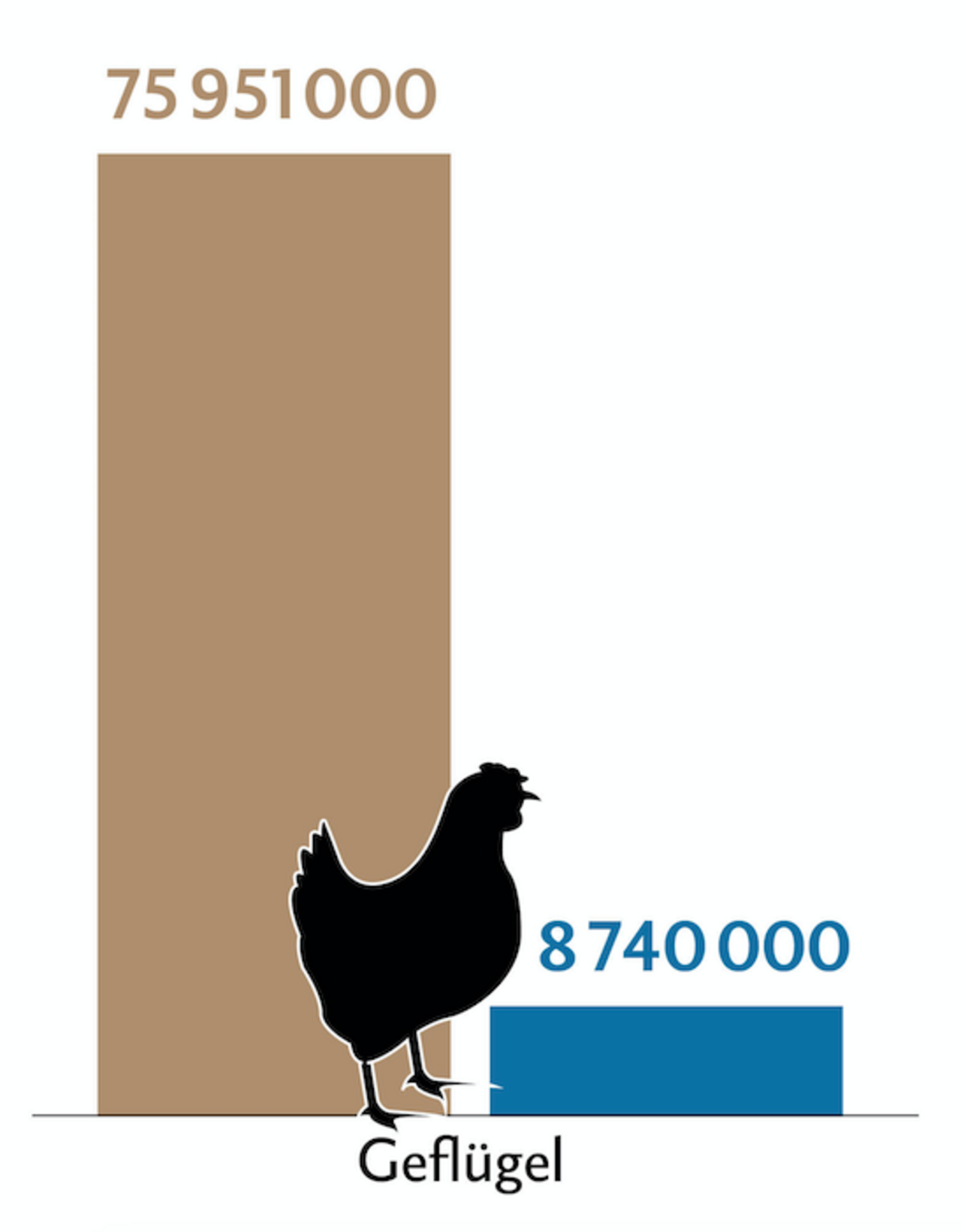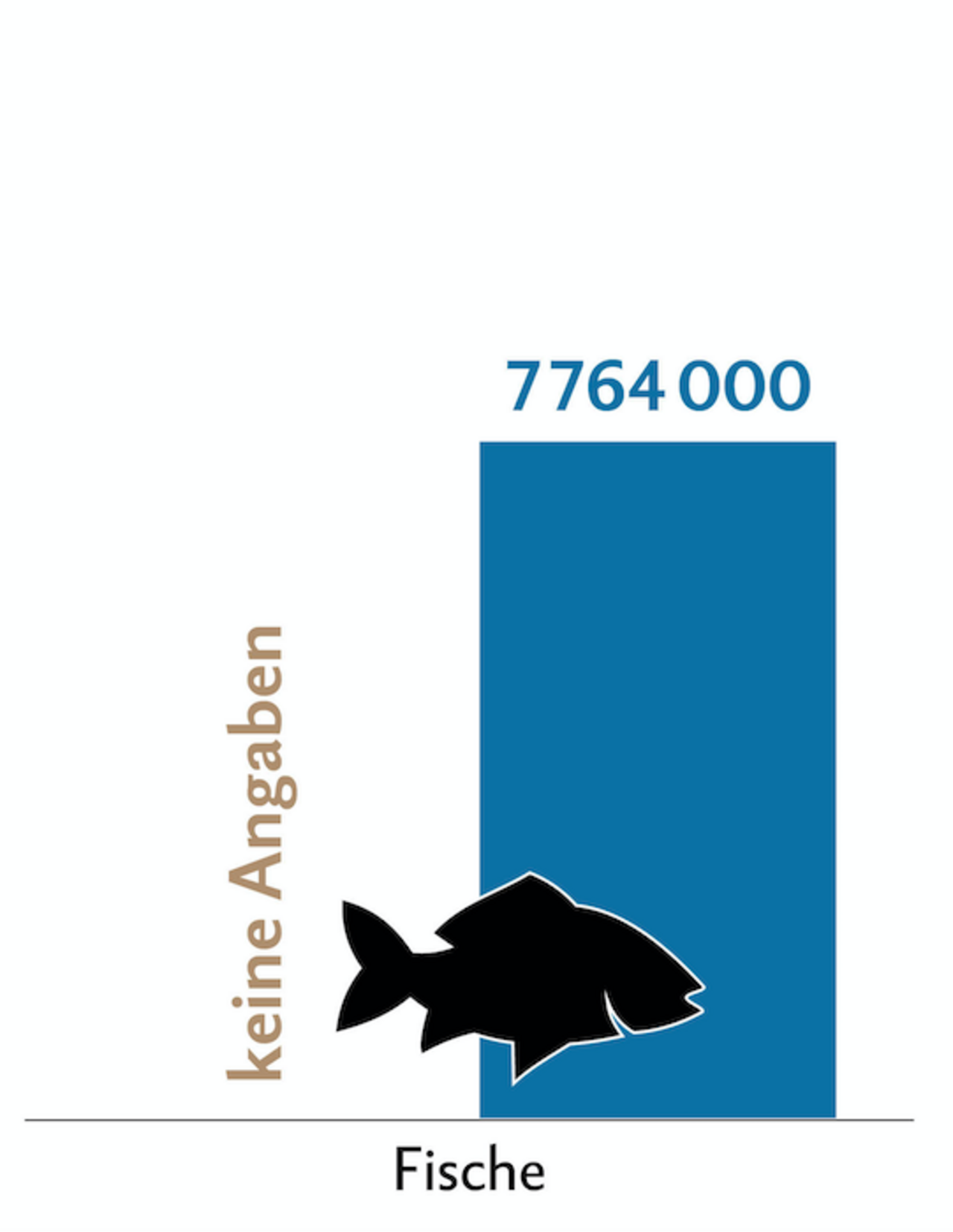Kurz & bündig - Der 1. Bericht zum «Informationssystem Antibiotika in der Veterinärmedizin» IS ABV ist vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV veröffentlicht worden. - Die Auswertungen im Bericht zum «Informationssystem Antibiotika in der Veterinärmedizin» beruhen auf Daten, die TierärztInnen 2020 bei ihrer alltäglichen Arbeit erhoben haben. - Absolut werden am meisten Hühner mit Antibiotika…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.