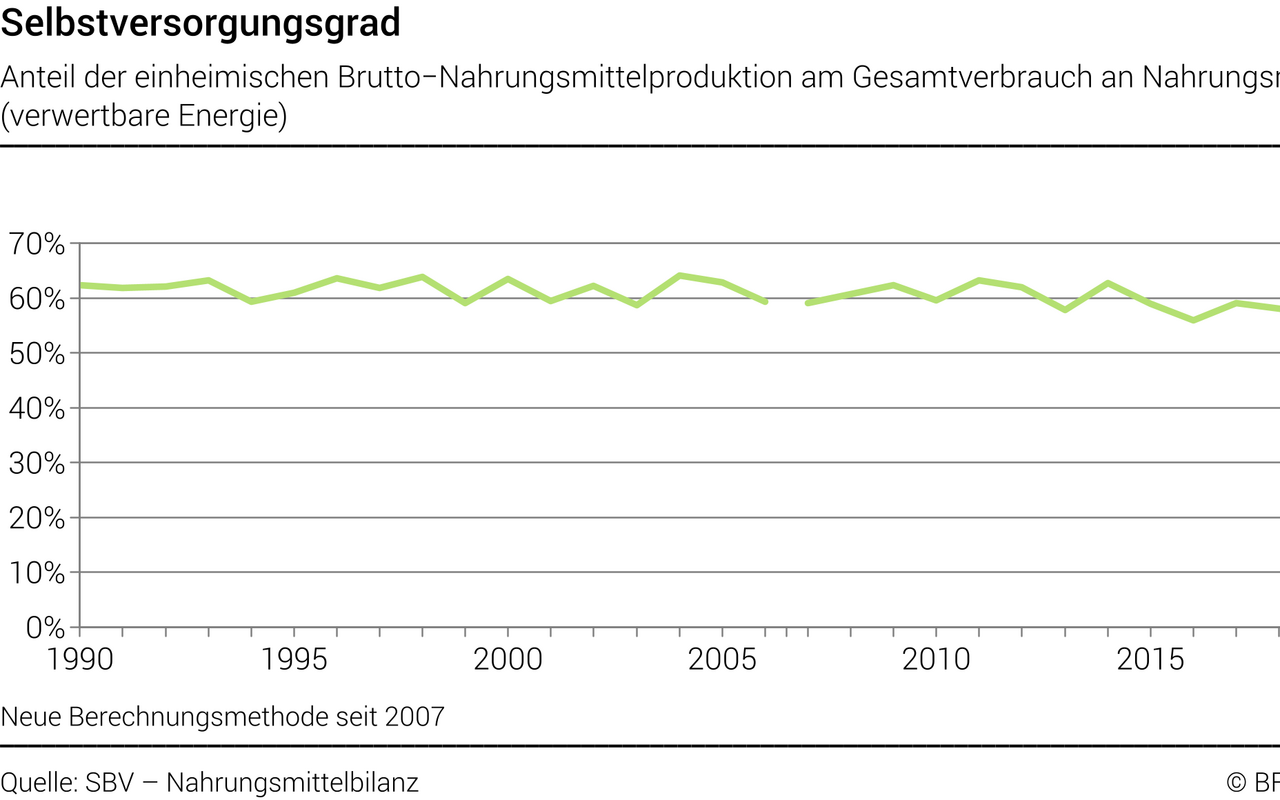Die Schweizerische Volkspartei SVP fordert als Folge des Krieges in der Ukraine einen «Plan Wahlen 2.0». Bis Ende März 2022 solle der Bundesrat aufzeigen, wie die Versorgungssicherheit der Bevölkerung sichergestellt werden kann. Konkret sollen mit einer «Anbauschlacht» wie im Zweiten Weltkrieg Biodiversitäts-Massnahmen rückgängig gemacht und stattdessen Nahrungsmittel angepflanzt werden. Was fordert die SVP mit dem…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.