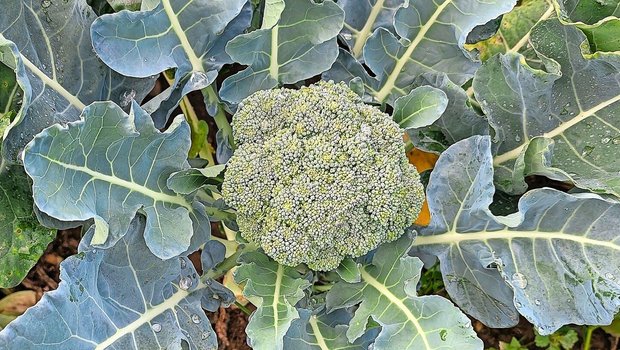Ein Betriebsleiter eines Mastbestandes mit 500 Tieren meldet sich beim Schweine Gesundheitsdienst (SGD). Der Grund: Seit mehreren Umtrieben treten ein bis fünf Tage nach Einstallung Lahmheiten auf. Betroffen sind etwa fünf Prozent aller Tiere. Zusätzlich tritt bei ungefähr zwei Prozent der Schweine Husten auf. Tiere der Endmast sind in der Regel nicht betroffen. Ausserdem meldet der Schlachthof, dass einige Tiere…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.