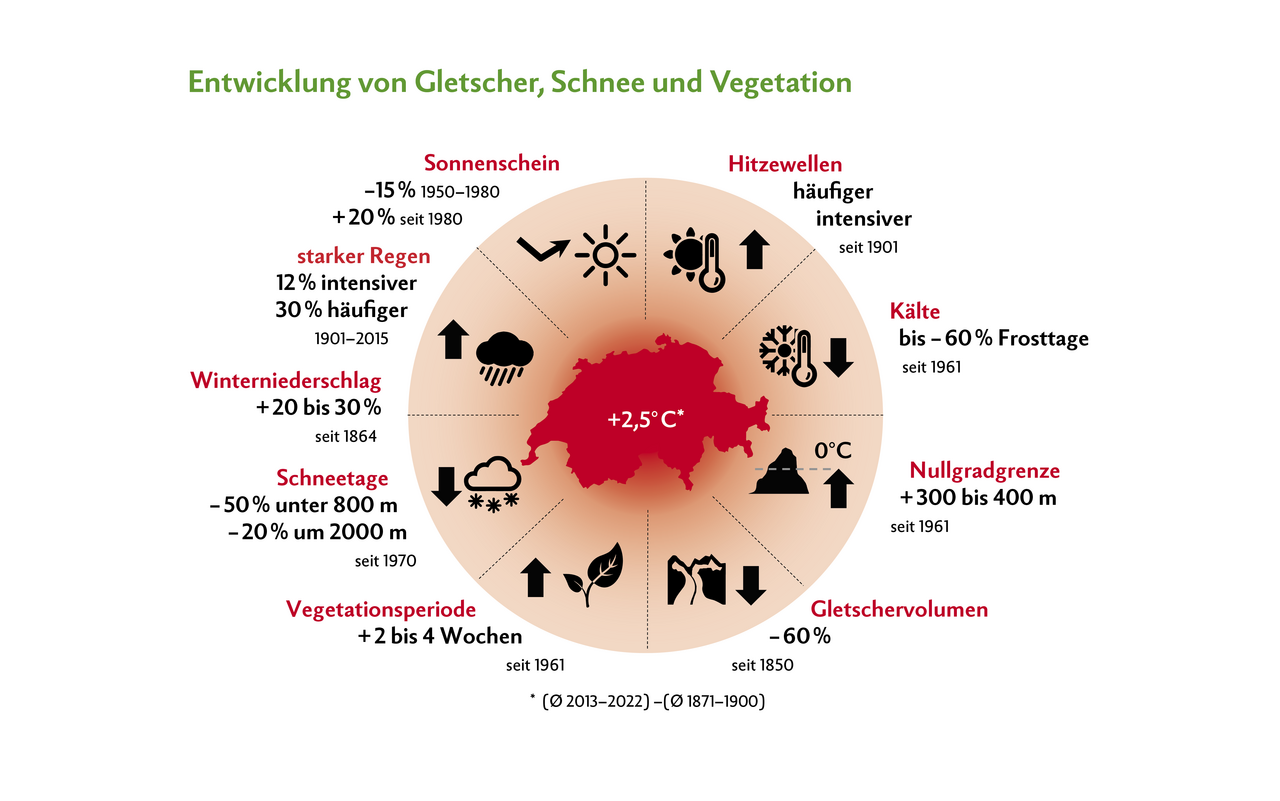Kurz & bündig - Meteorologe Gaudenz Flury erklärt, dass auf der Alpensüdseite tatsächlich Wasser fehlt, die Lage im Flachland und auf der Alpennordseite aber innerhalb der Norm sei. - In der Tendenz müssen Landwirte mit heissen, trockenen Sommern und mehr Niederschlag im Winter rechnen. - Zudem kommt es wegen dem Klimawandel zu mehr extrem Wetterereignissen. Zunächst klingt es etwa so trocken, wie der Sommer 2022…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 7 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.