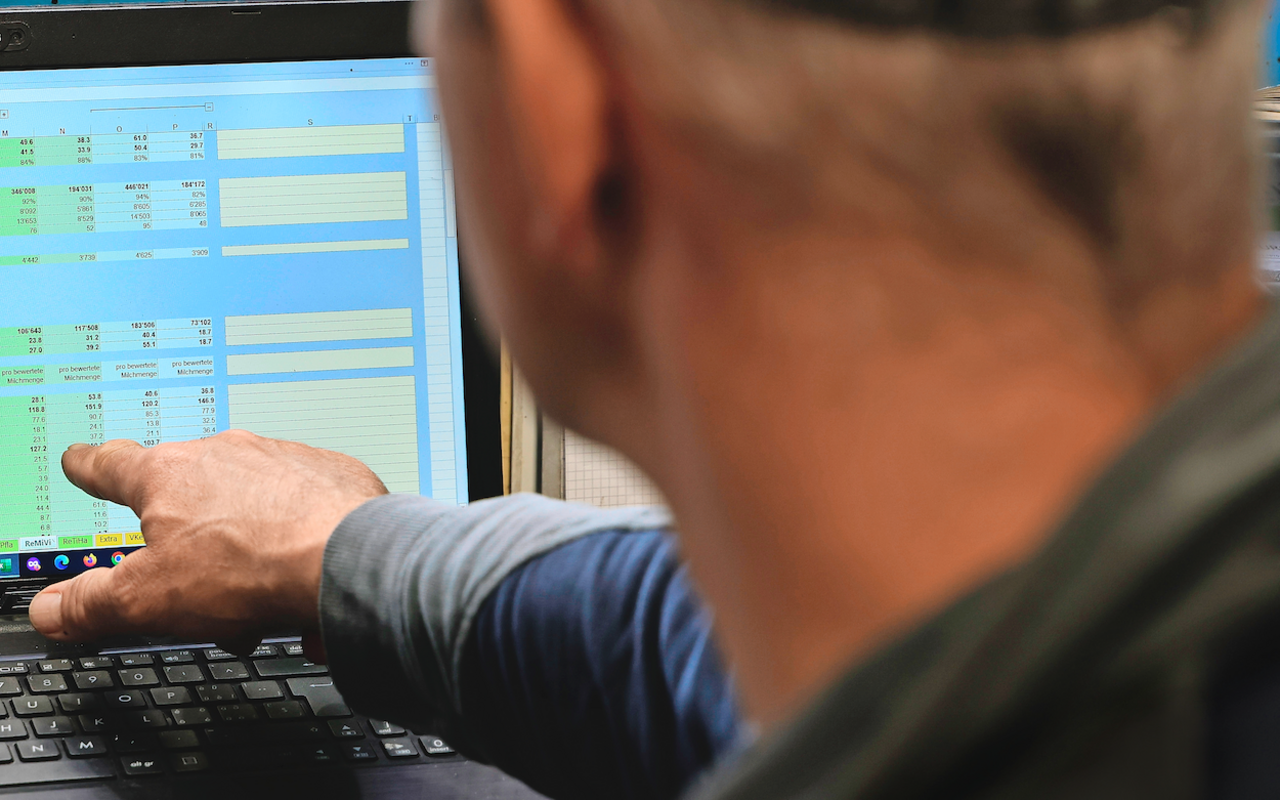Kurz & bündig - Die Vollkostenrechnung zeigt die Rentabilität einzelner Betriebszweige auf und lässt den Vergleich mit anderen Betrieben zu. - Landwirt Andreas Nussbaumer berechnet die Vollkosten der Milchproduktion seit 20 Jahren selbst. - Der Landwirt würde jedem empfehlen, seine Vollkosten auszurechnen. Grundvoraussetzung ist die Freude an der Buchhaltung. «Ich zeige Ihnen den leeren Stall eben genau, weil er…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.