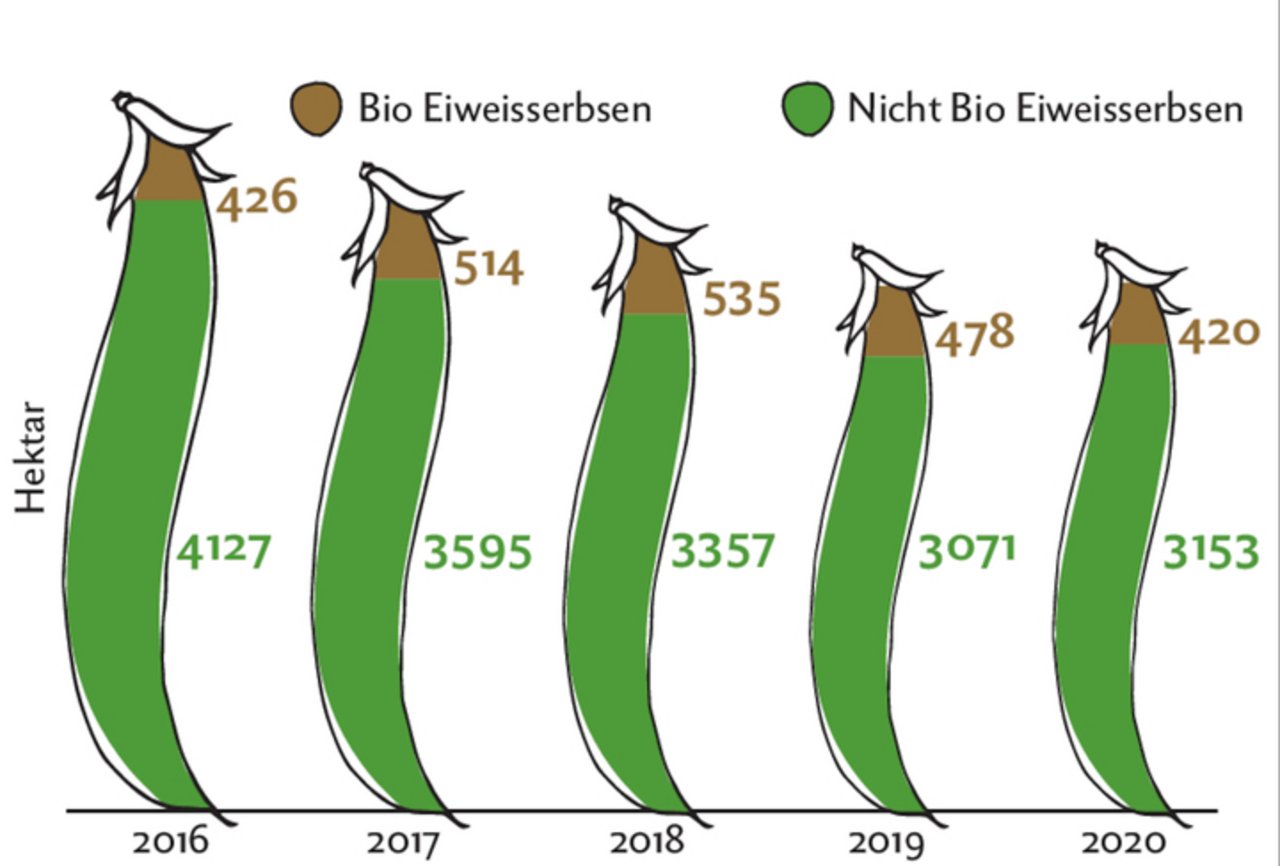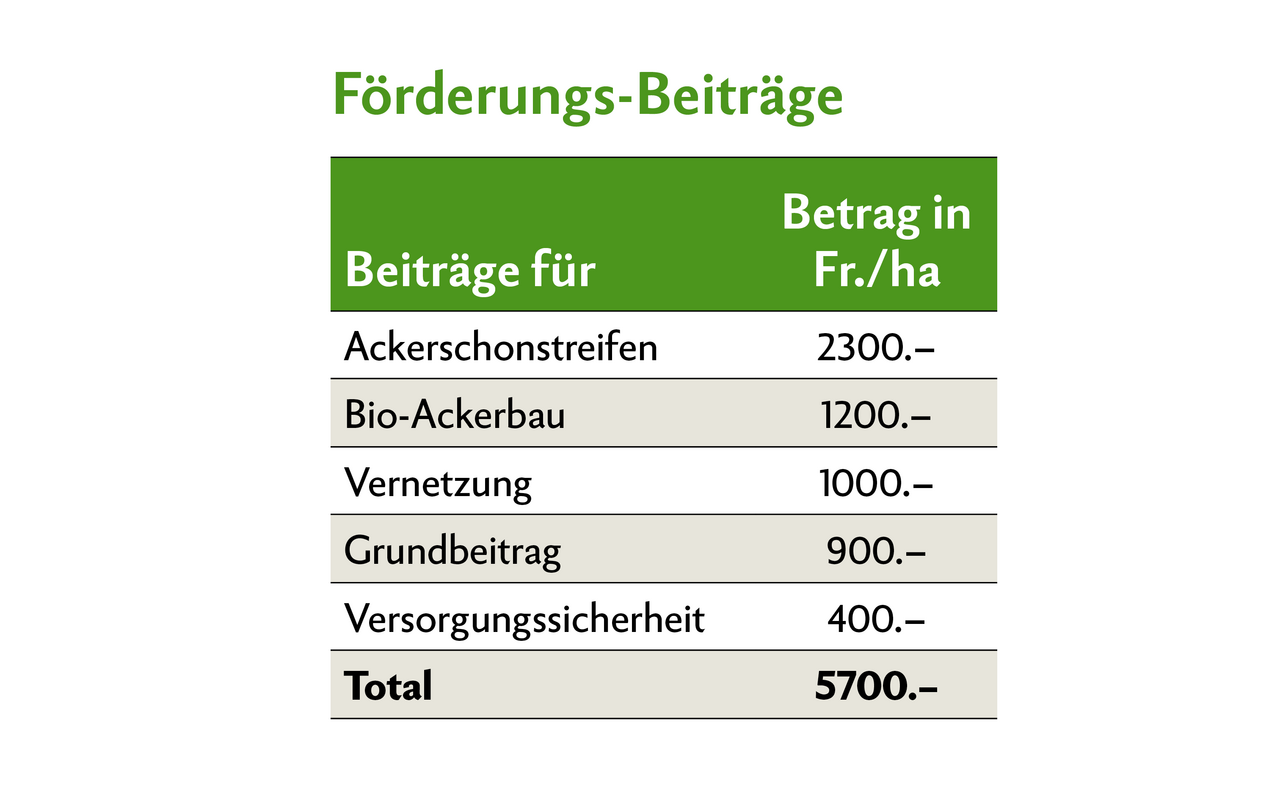Kurz & bündig - Die Ergänzung von Gerste mit Erbsen führt zu einem eiweissreicheren Futter. - Die Gerste dient den Erbsen als Stützfrucht. - Erbse ist eine Leguminose, sie benötigt keine Stickstoff-Düngung und hinterlässt Stickstoff für die Nachfrucht. - In einer Grastrocknungs-Anlage wird das Gemisch erhitzt und pelletiert. - Der einfache Anbau des Gemisches macht es möglich, die ganze Fläche als…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.