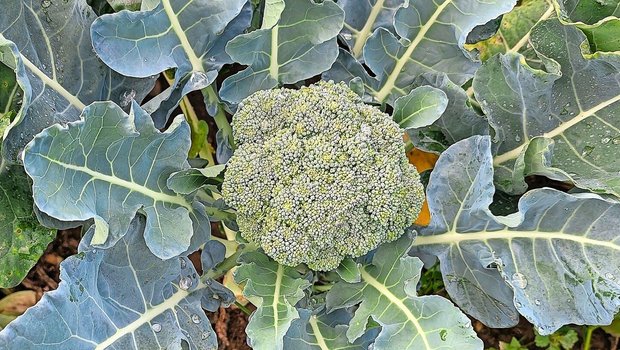Kurz & bündig - Biologischer und konventioneller Ackerbau rücken näher zusammen. - Die Gesamtbetrieblichkeit ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. - Precision Farming kann unterstützen, löst aber nicht alle Probleme. - Gesucht sind vor allem anbautechnisch anspruchsvolle Kulturen wie Raps oder Zuckerrüben. - Der Erhalt vielseitiger Betriebe ist wichtig. Herr Dierauer, im ÖLN fallen immer mehr zugelassene…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 10 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.