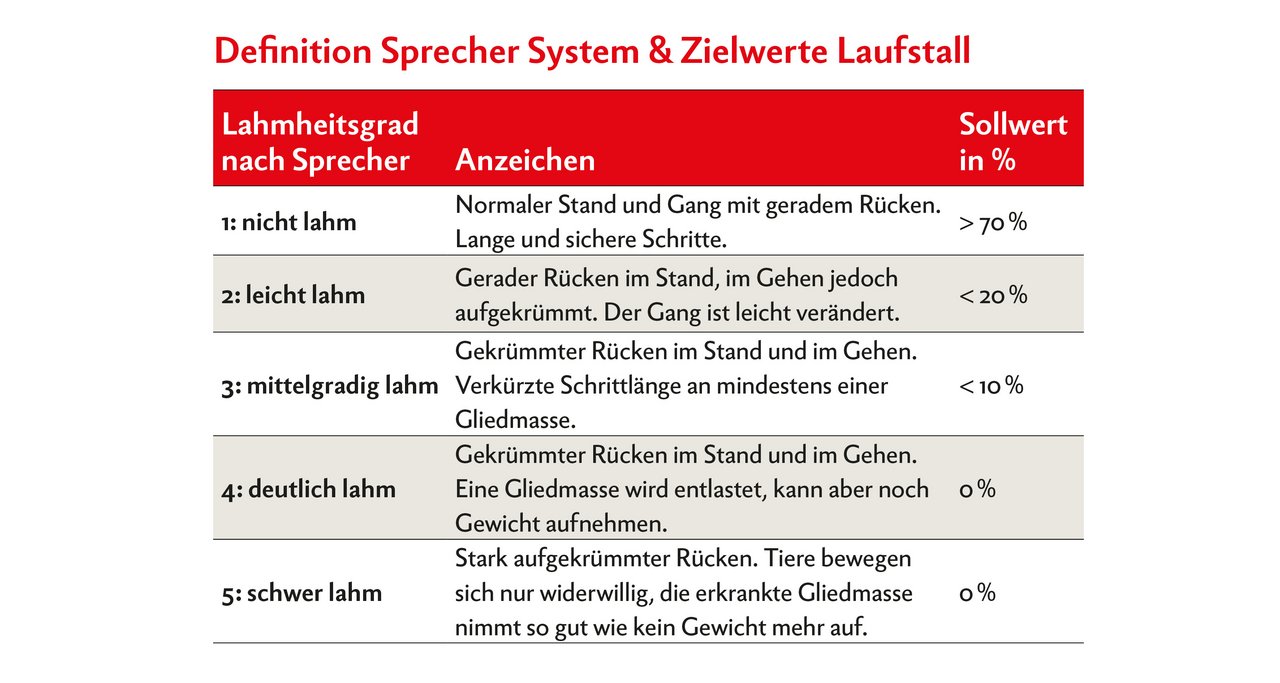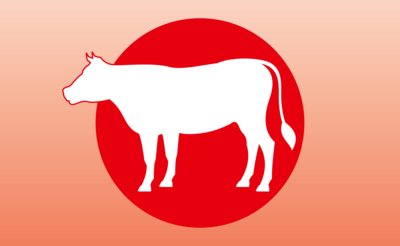Kurz & bündig - Schmerzhafte Lahmheit und Klauenerkrankungen sind die dritthäufigste Abgangsursache beim Schweizer Milchvieh. - Lahmheitsursachen sind beim Rind zu 90 Prozent an der hinteren Aussenklaue zu finden. - Die Behandlung eines Sohlengeschwürs einer Milchkuh kostet bis zu 900 Franken. - Eine frühe Lahmheitserkennung sowie eine passende Behandlung sind entscheidend für den Heilungserfolg. Vorgehen auf dem…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.