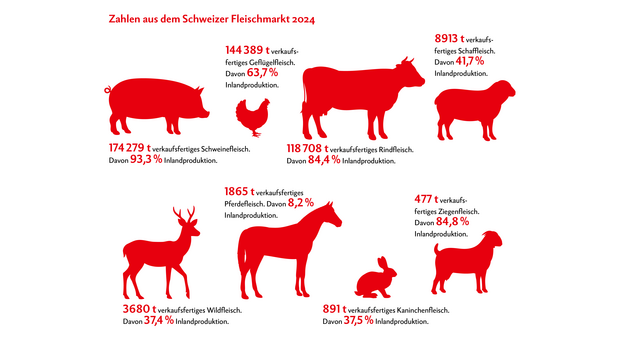Kurz & bündig - Fünf Landwirte aus der Region bringen jeden Morgen ihre Bio-Milch in die Käserei «Le Sapalet» in Rossinière VD. - «Le Sapalet» ist auf Schafsmilchprodukte spezialisiert, verarbeitet aber auch Kuh- und Ziegenmilch. - Die gelieferte Bio-Milch wird hin und wieder zur Kontrolle und Analyse beprobt. Das Arbeits-verhältnis zwischen Käserei und Landwirten beruht auf einer soliden Vertrauensbasis. Es ist…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 10 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.