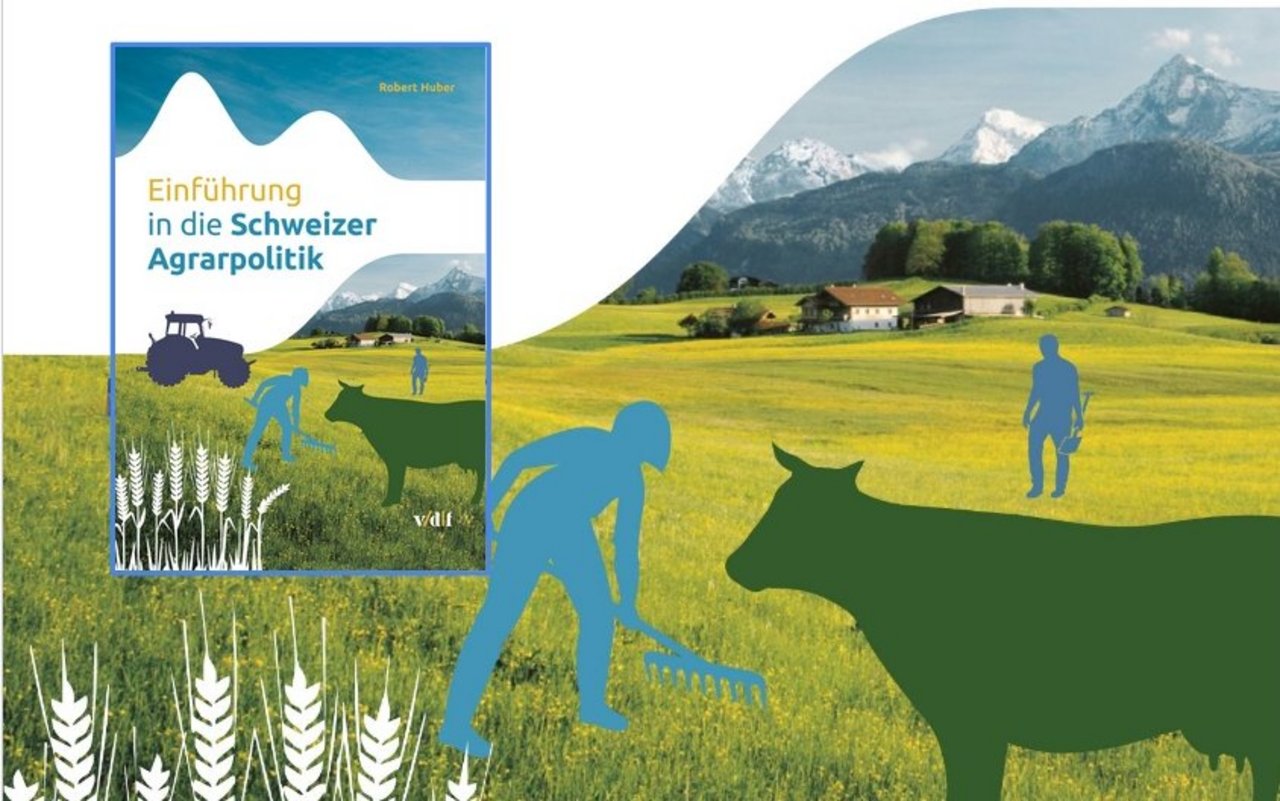Die Schweizer Agrarpolitik ist für viele LandwirtInnen ein Buch mit sieben Siegeln. Wer ausser den wenigen Insidern versteht schon zum Beispiel die vertrackten Mechanismen der Milchpolitik und Milchwirtschaft? Das nötige Basiswissen zur Agrarpolitik vermittelt das Fachbuch «Einführung in die Schweizer Agrarpolitik» von Robert Huber. Der Autor ordnet in diesem neuen Standardwerk agrarpolitische Zusammenhänge aus…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 9 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.