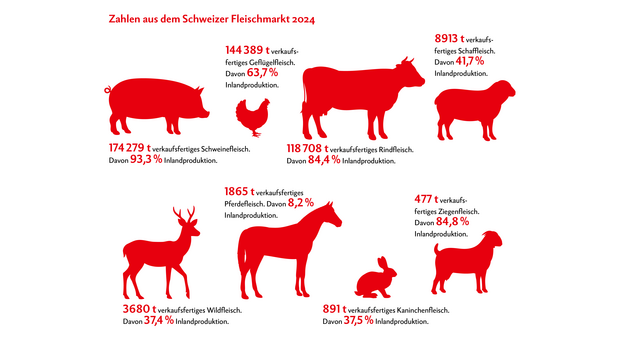Kurz & bündig Hitzestress ist für Schweine im Sommer ein grosses Problem. Sind Stalltemperatur und relative Luftfeuchte zu hoch, geraten sie in eine Notsituation. In der Not suhlen sich die Schweine im Kot, reduzieren ihre Nahrungsaufnahme und zeigen vermehrt Fehlverhalten wie Schwanzbeissen. Die Optimierung der klimatischen Bedingungen im Schweinestall ist meist mit hohen Investitionen und baulichen Veränderungen…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.