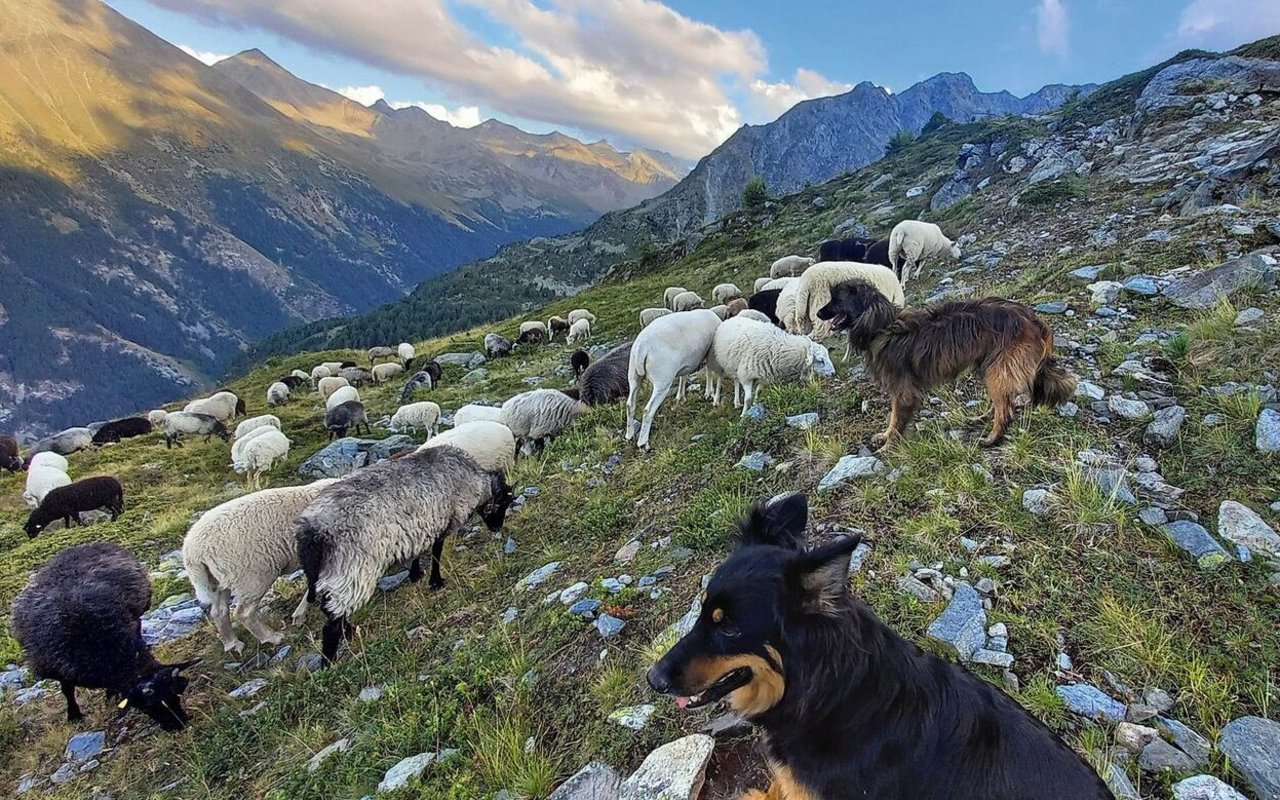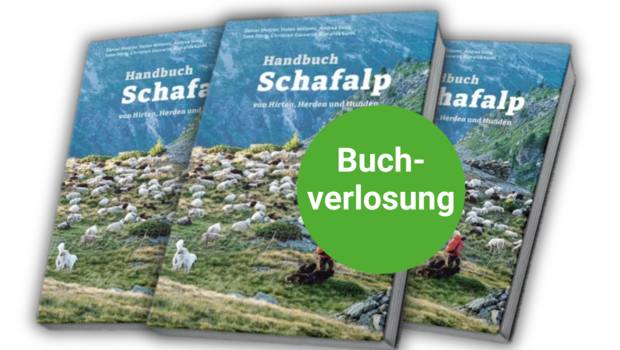Kurz & bündig - Schafhirtin Sarah Müri schützt ihre Schafe mit ihren Schutzhunden und im Nachtpferch. - Die Arbeit ist anstrengend und der Wolfsdruck erfordert zusätzliche Arbeitsstunden. - Gleichzeitig fehlen schweizweit Fachpersonen auf den Schafalpen – eine Herausforderung für den Herdenschutz. Wenn Sarah Müri erzählt, wird klar: Der Herdenschutz ist in erster Linie eine anstrengende Arbeit, die nie endet. Sie…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 9 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.