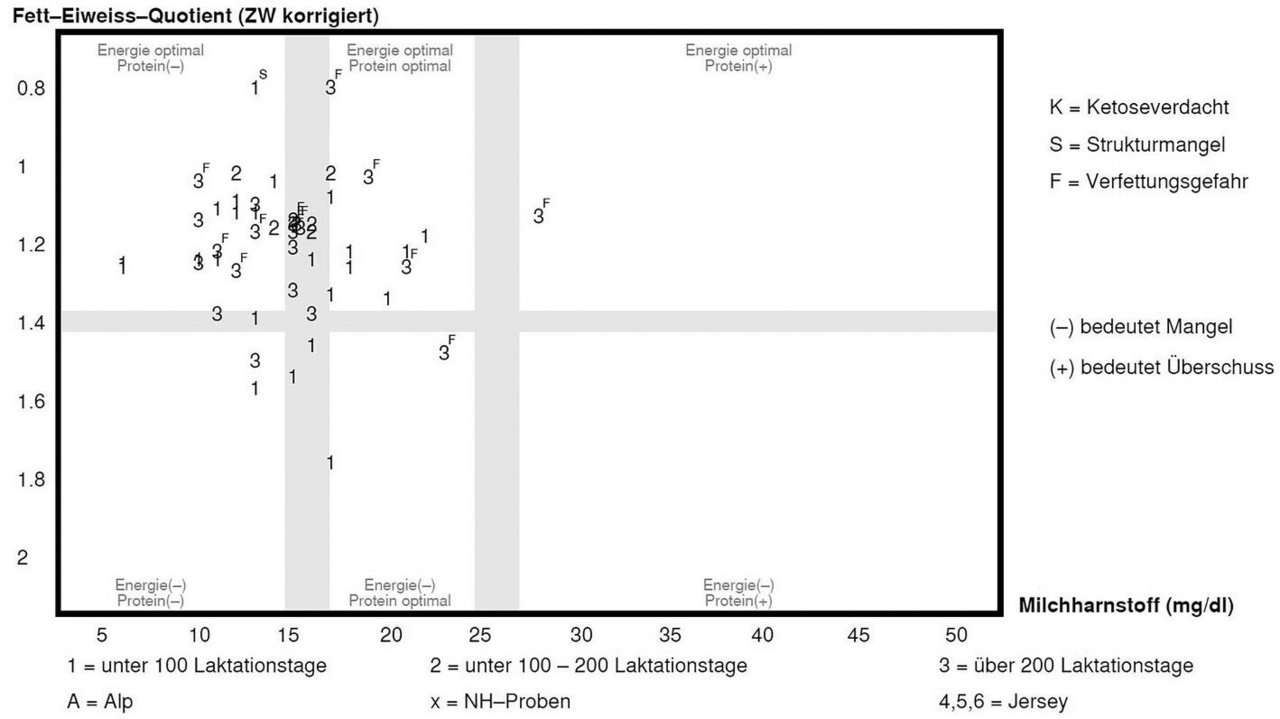Bei der Milchleistungsprüfung MLP werden Fett- und Eiweissgehalt, Laktose- und Harnstoffwerte und weitere Parameter im Labor gemessen. Die Daten dienen den Zuchtverbänden als wichtige Information für die Zuchtarbeit. LandwirtInnen erhalten die Milchleistungsdaten ihrer Kühe ebenfalls. Auf der bisherigen 9-Felder-Tafel kann der Landwirt auf einen Blick sehen, ob er seine Kühe richtig füttert oder ob…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 3 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.