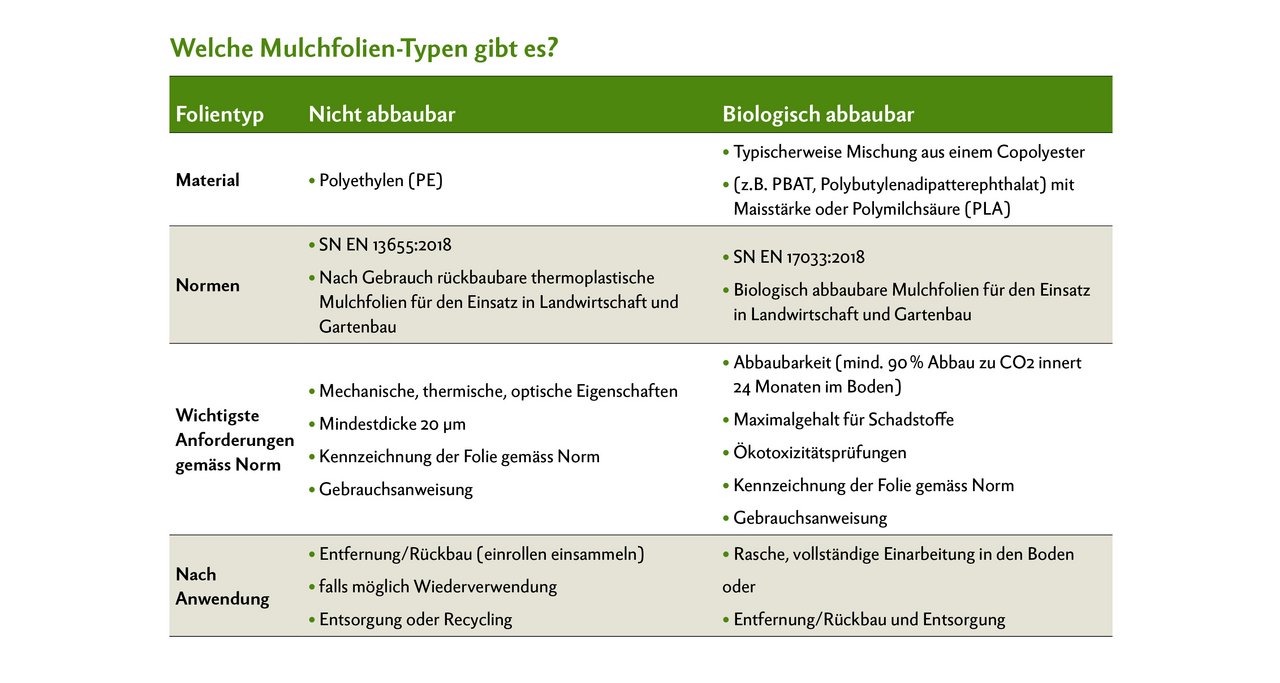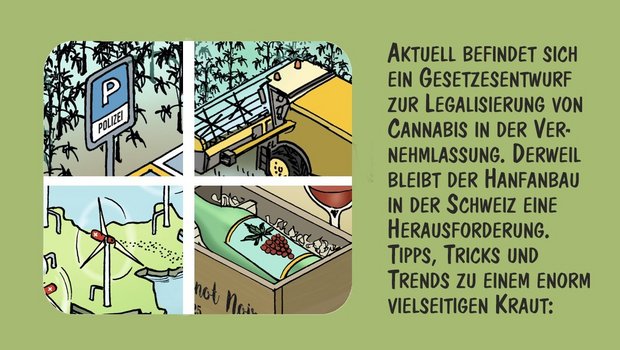Kurz & bündig - Dank Mulchfolien braucht es weniger Herbizide und weniger Bewässerung. - Die biologisch abbaubaren Folien müssen aber korrekt in den Boden eingearbeitet werden. - Nicht abbaubare Folien müssen nach der Anwendung entfernt, rezykliert oder entsorgt werden. - Nicht vollständig abgebaute Mulchfolienreste landen in der Landschaft oder im Heu, was zu Reklamationen führt. Gerade während des…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.