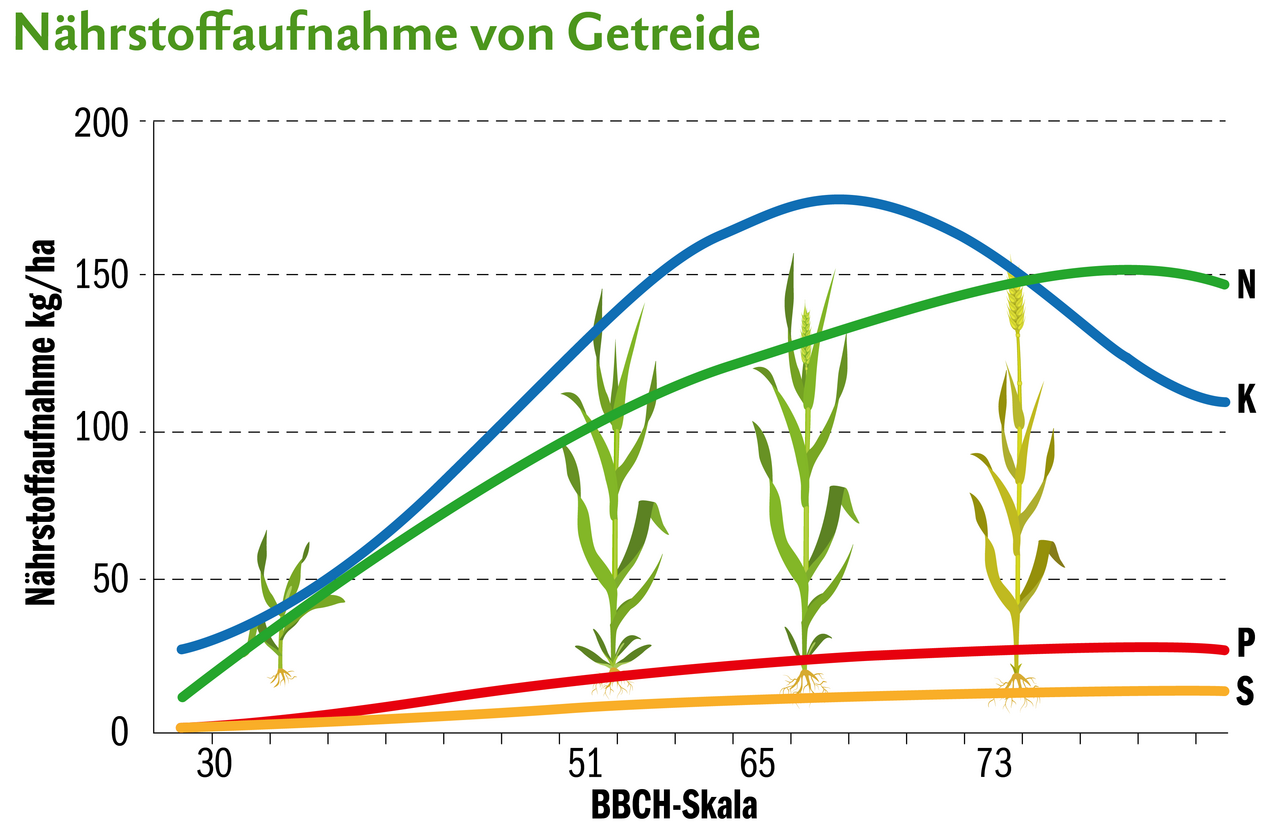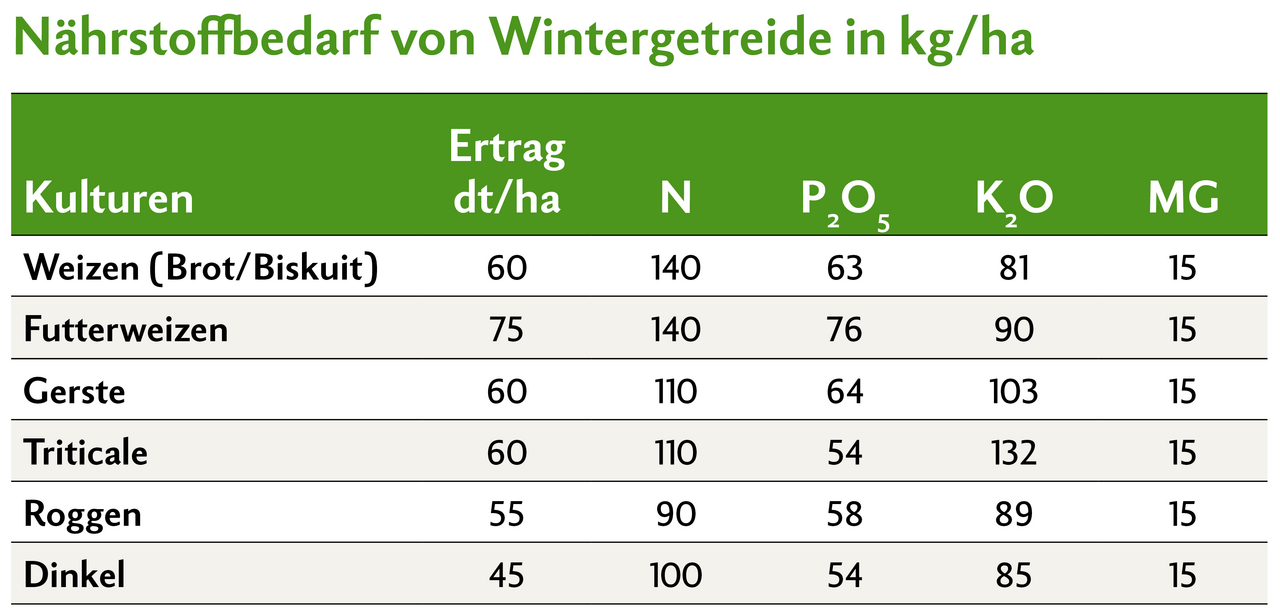Kurz & bündig - Bei beiden Strategien ist die erste Düngergabe mit schnell verfügbarem Stickstoff entscheidend für einen guten Start. - Die 3-Gaben-Strategie eignet sich für Standorte mit hohem Ertragspotenzial und wenig Sommertrockenheit, da sie eine optimale Düngung und Qualitätssteigerung ermöglicht. - Die 2-Gaben-Strategie ist ideal für Standorte mit höherem Sommertrockenheitsrisiko und spart eine Überfahrt ein,…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.