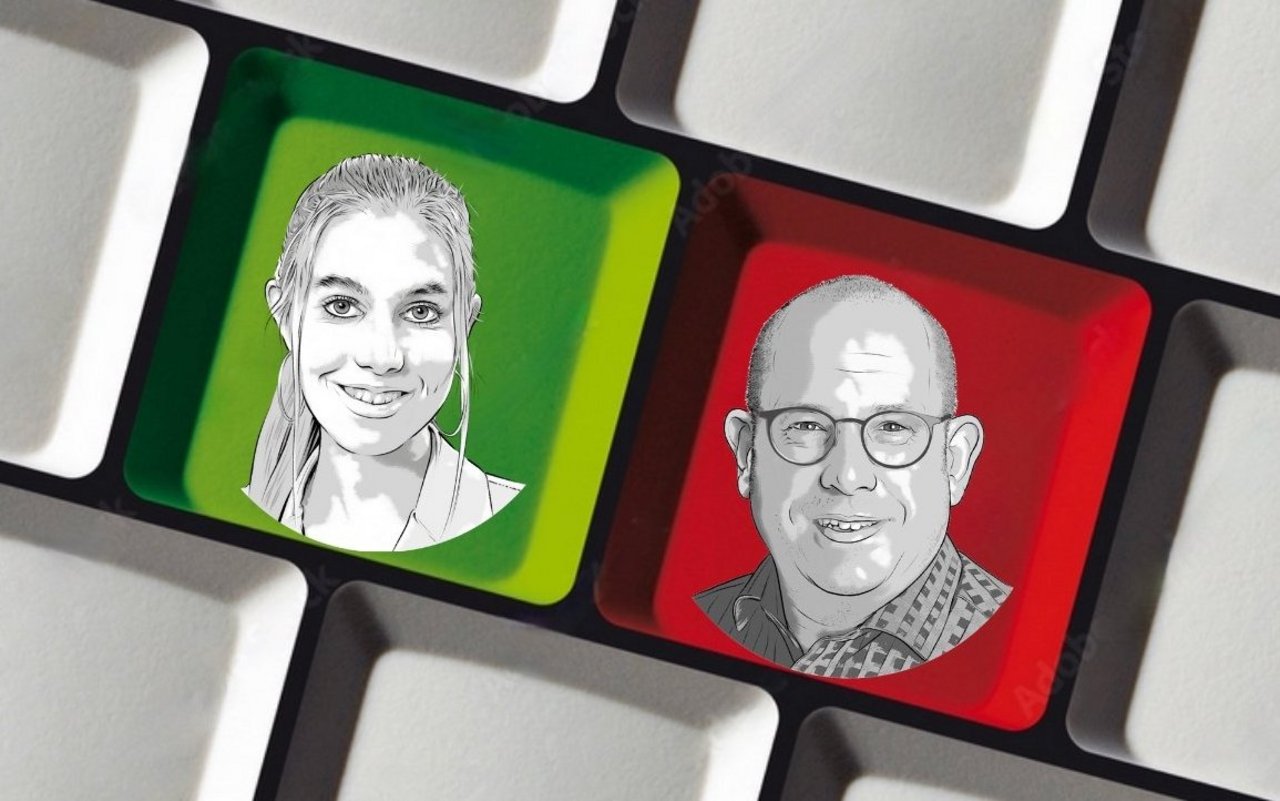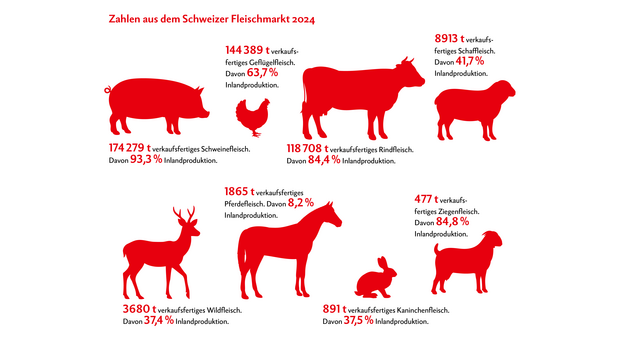Im Laufe des Jahres 2022 stellen wir der Initiantin der Massentierhaltungs-Initiative MTI, Meret Schneider, und je einem Vertreter der Schweizer Züchter und Produzenten von Rindern, Schweinen und Geflügel dieselben fünf Fragen. So erhalten wir drei interessante «Pro & Contra»-Diskussionen zur Massentierhaltungs-Initiative MTI und deren Folgen. Im ersten «Pro & Contra» stehen sich gegenüber: Meret Schneider,…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 7 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.