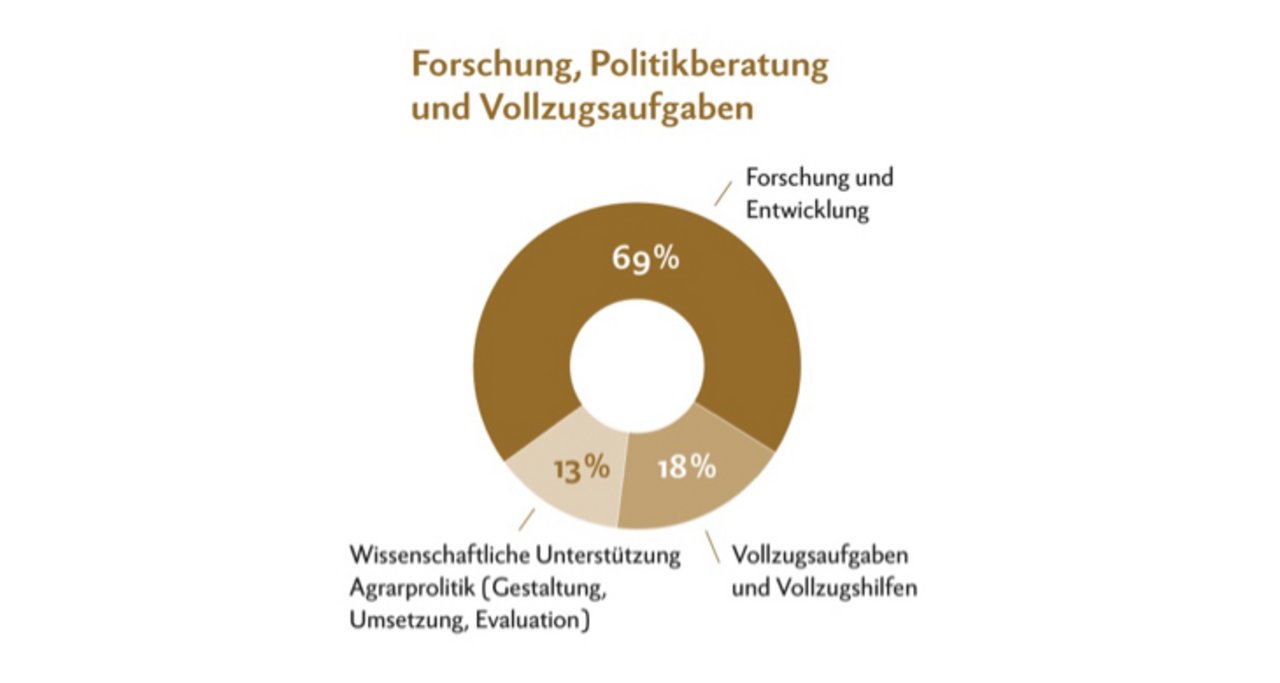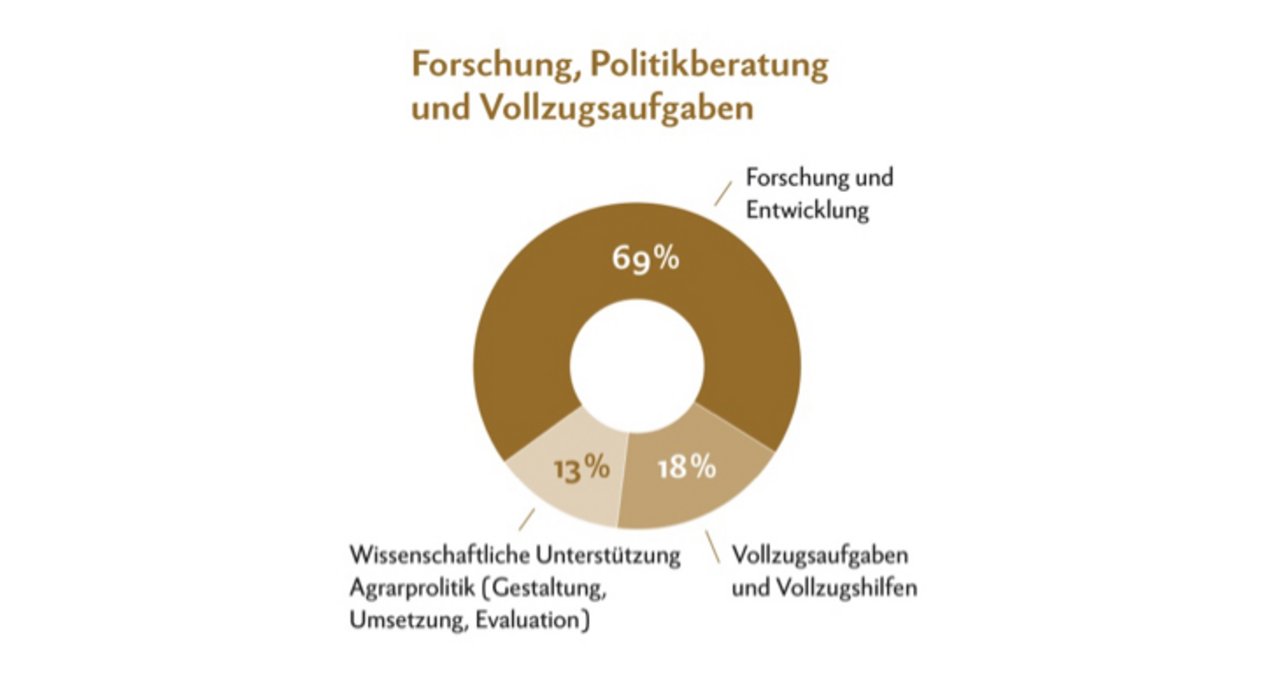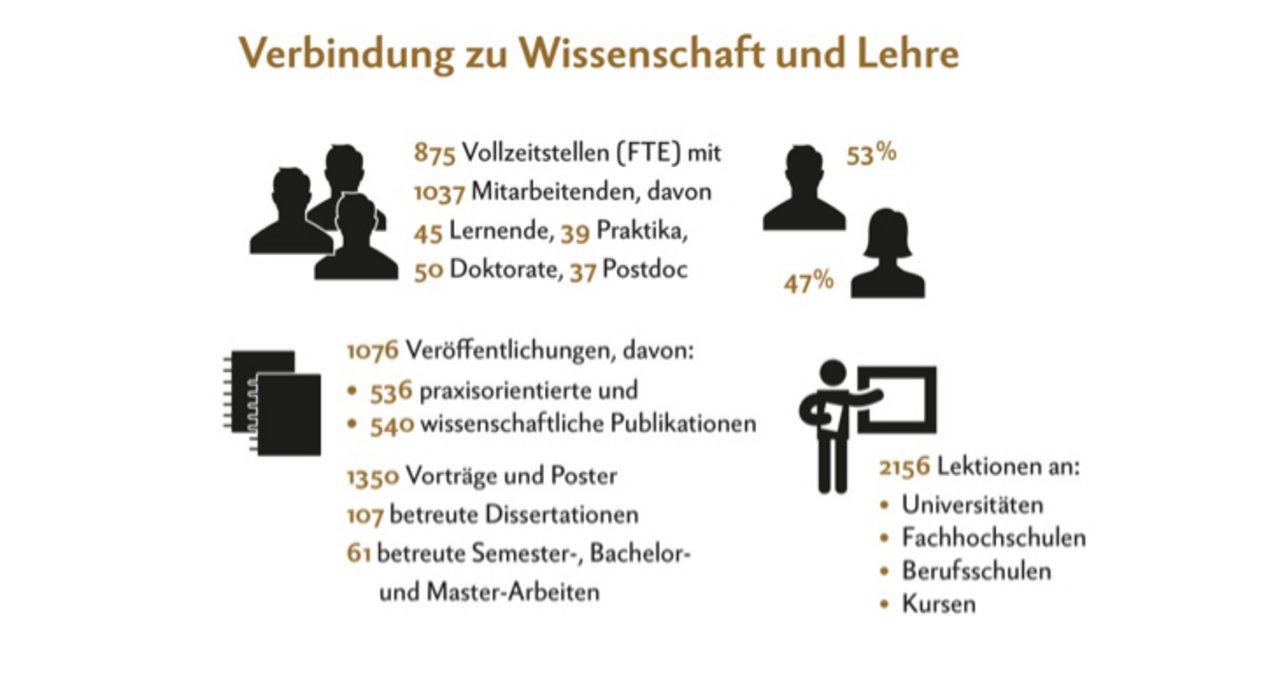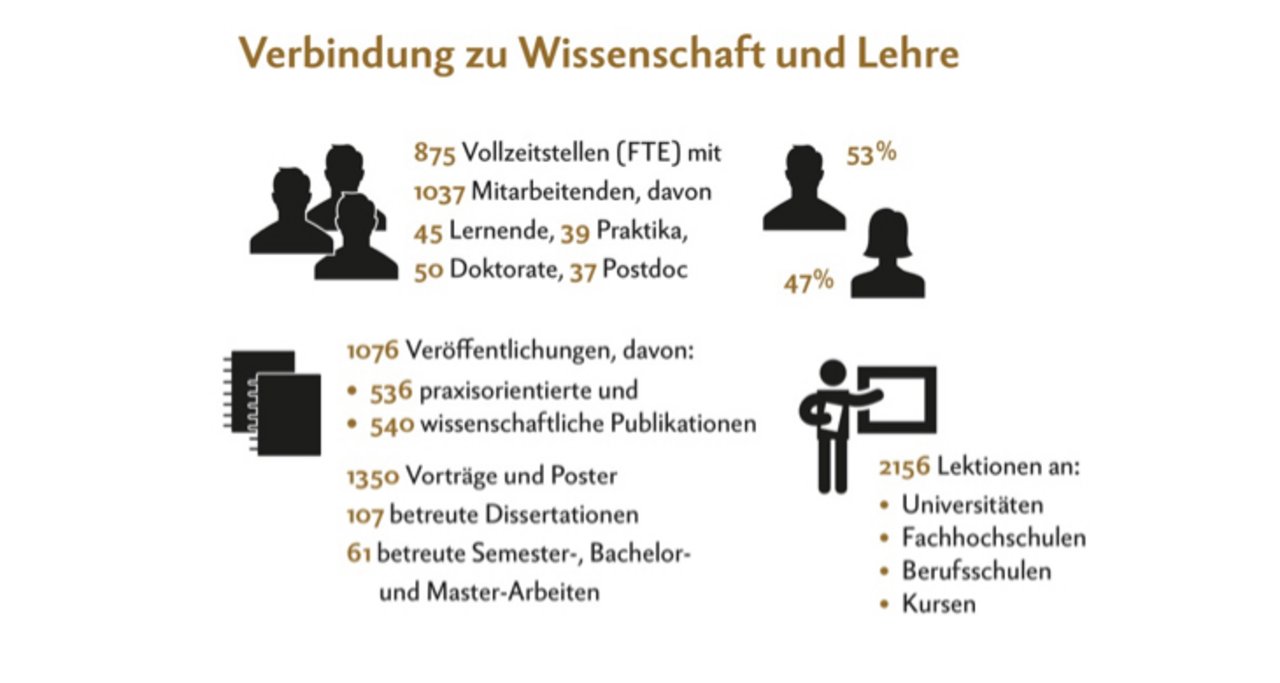Agroscope ist das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung und ist dem Bundesamt für Landwirtschaft BLW angegliedert. Die Forschung erfolgt entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft, wobei sich die Forschungsanstalt auf die Bedürfnisse ihrer Leistungsempfänger ausrichtet. Der Name Agroscope setzt sich zusammen aus den griechischen Begriffe «agrós»…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 3 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.