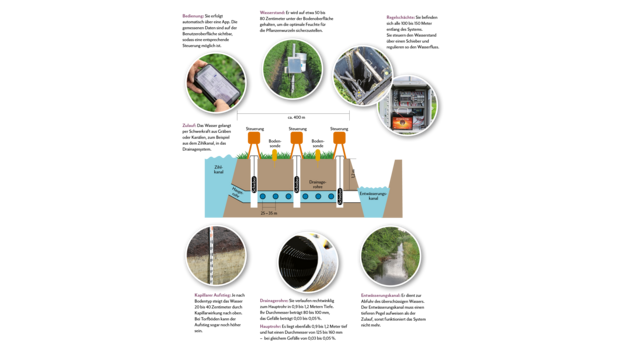Kurz & bündig -Die Drohne mit Wärmebildkamera ist ein Meilenstein in der Rehkitzrettung. -Jäger Ernst Krebs kann mit der Drohne viel mehr Flächen absuchen. -Gefundene Kitze werden mit einer Harasse gesichert und die Stelle wird markiert. [IMG 2]Die Rehkitzrettung wird traditionellerweise durch die Jagdvereine durchgeführt. Ernst Krebs, Hegeobmann des Jagdvereins Laupen BE, ist einer dieser Freiwilligen, die sich…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 10 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.