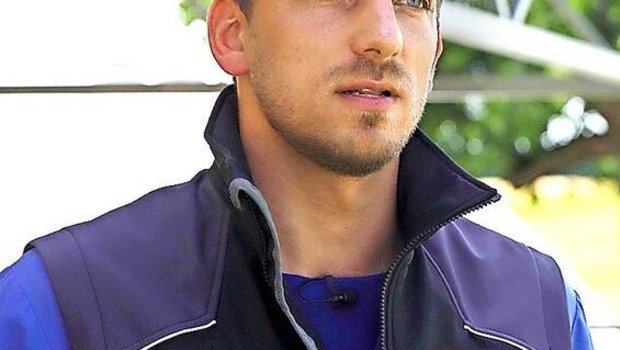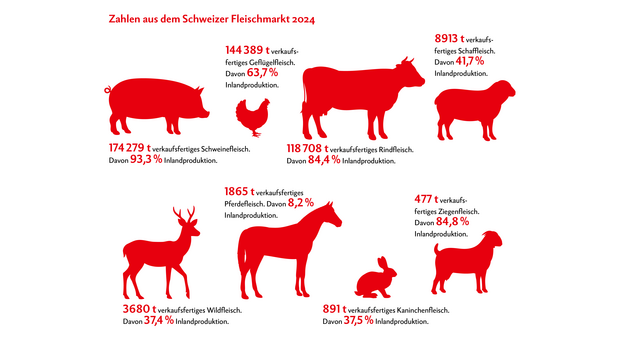Kurz & bündig - Plötzliches Ansteigen der Zellzahl in der Milch kann Streuströme als Ursache haben. - Zur Behebung von Spannungsdifferenzen unbedingt eine kontrollberechtigte Elektro-Fachperson beiziehen! - Bei der Planung die Erdung auf einen zentralen Erdungspunkt ausrichten. Das Umfeld miteinbeziehen. Die Zellzahl in der Tankmilch fing plötzlich an zu steigen, in anderthalb Monaten von 100'000 auf 300'000…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.