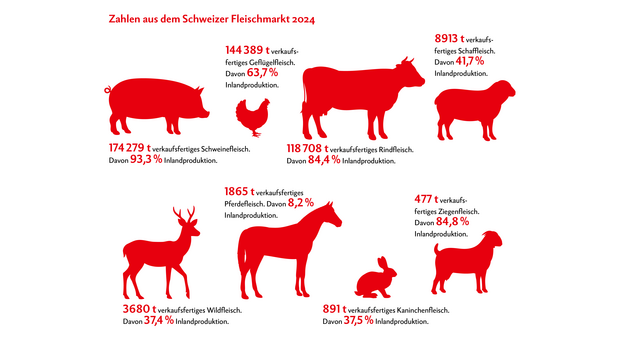Kurz & bündig - Die Moderhinke ist eine ansteckende Klauenkrankheit. - Das Erregerbakterium kann bis zu vier Wochen im Boden überdauern. - Auch klinisch gesunde Klauen können den Erreger in sich tragen. - Tupferproben ermöglichen, den versteckten Erreger zu finden. - Eine Sanierung der Bestände ist zwar aufwändig, aber sie lohnt sich. - Ziel ist ein nationales Bekämpfungsprogramm, um Re-Infektionen zu vermeiden. …
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.