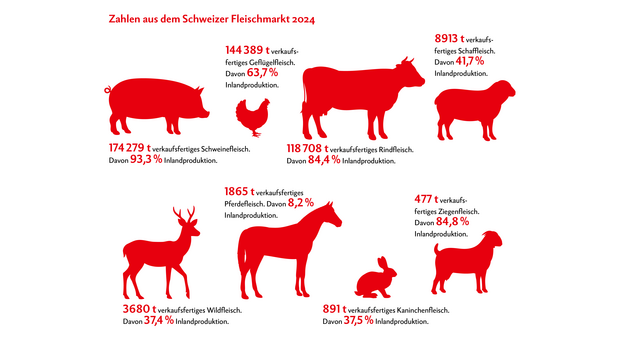Im Rindviehstall Rütti am Inforama in Zollikofen BE wurde die Wirkung von Klauenklötzen untersucht. Der Stall wird von der Pächterfamilie Emmenegger geführt und von Forschenden der Berner Fachhochschule HAFL und der Wiederkäuerklinik der Vetsuisse-Fakultät, Universität Bern, für praxisnahe Versuche genutzt. Die Tierärztin Denisa Dan ist Koordinatorin der Versuche und bereitet das neue Wissen für die Praxis auf. Die…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.