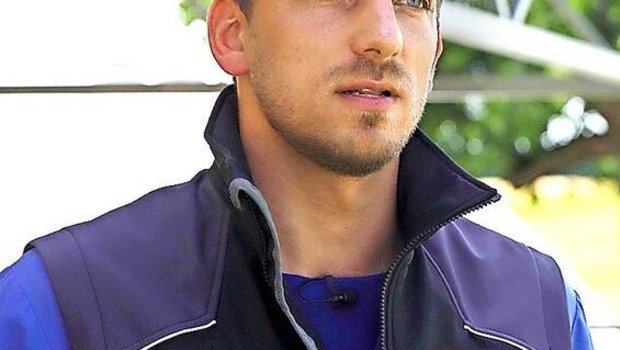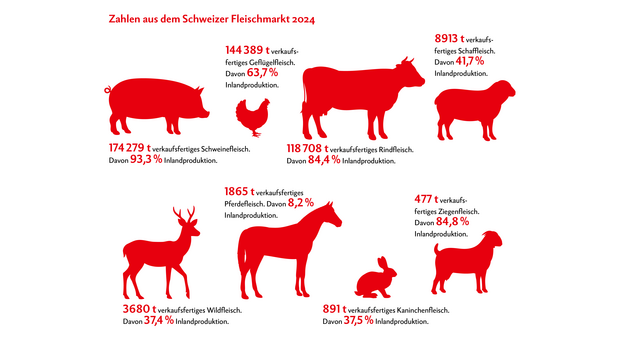Kurz & bündig - Die Muttertiere werden abends kontrolliert und bei Bedarf ausgemolken. - Meistens ist der Milchfluss gut. Aber ganz ohne Oxytocin gehe es nicht. - Das sei der einzige Nachteil der muttergebundenen Kälberaufzucht. - Der Mehrwert des Fleisches und der Milch wird zurzeit noch nicht ausgelobt. - Das kann sich in Zukunft ändern, denn die Nachfrage der Konsumenten ist da. Braune, rote, schwarze Kühe – die…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 7 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.