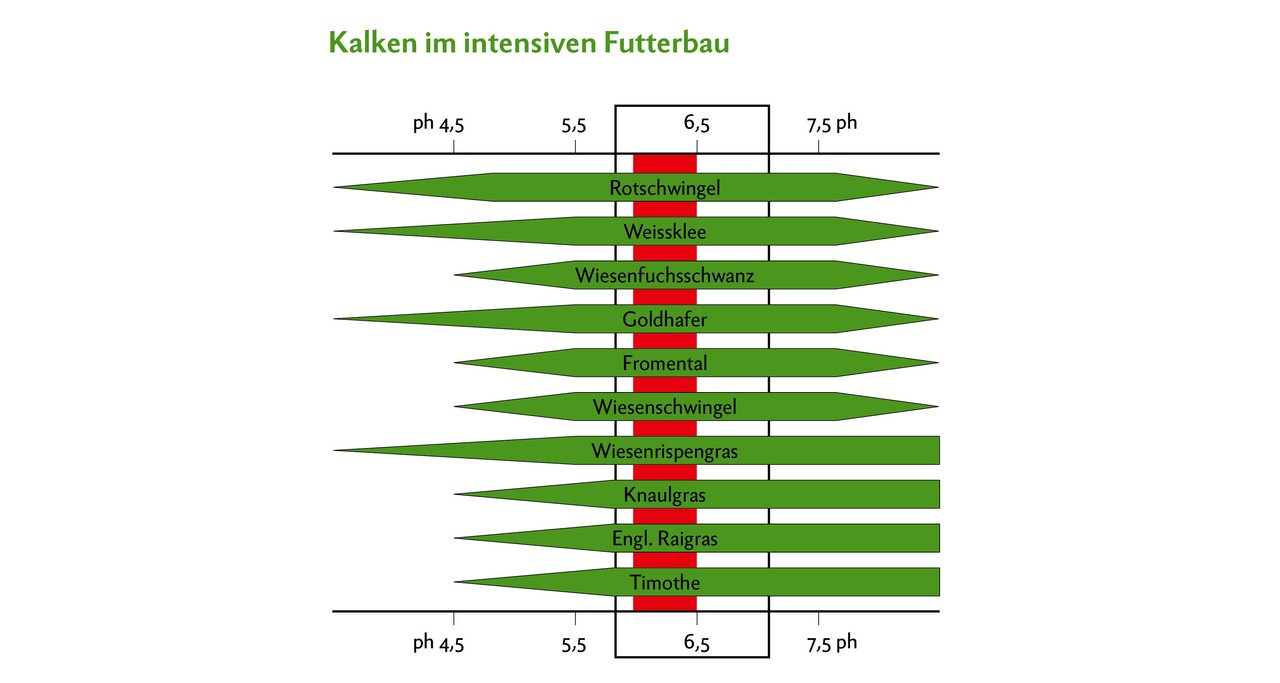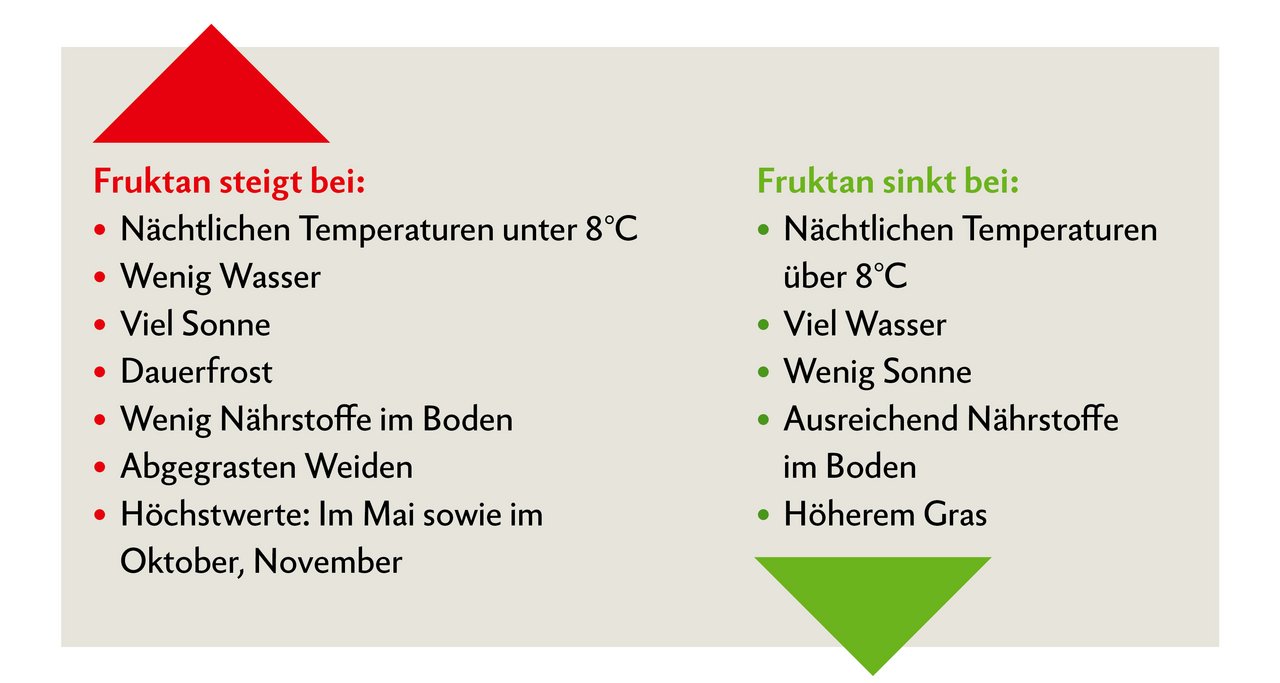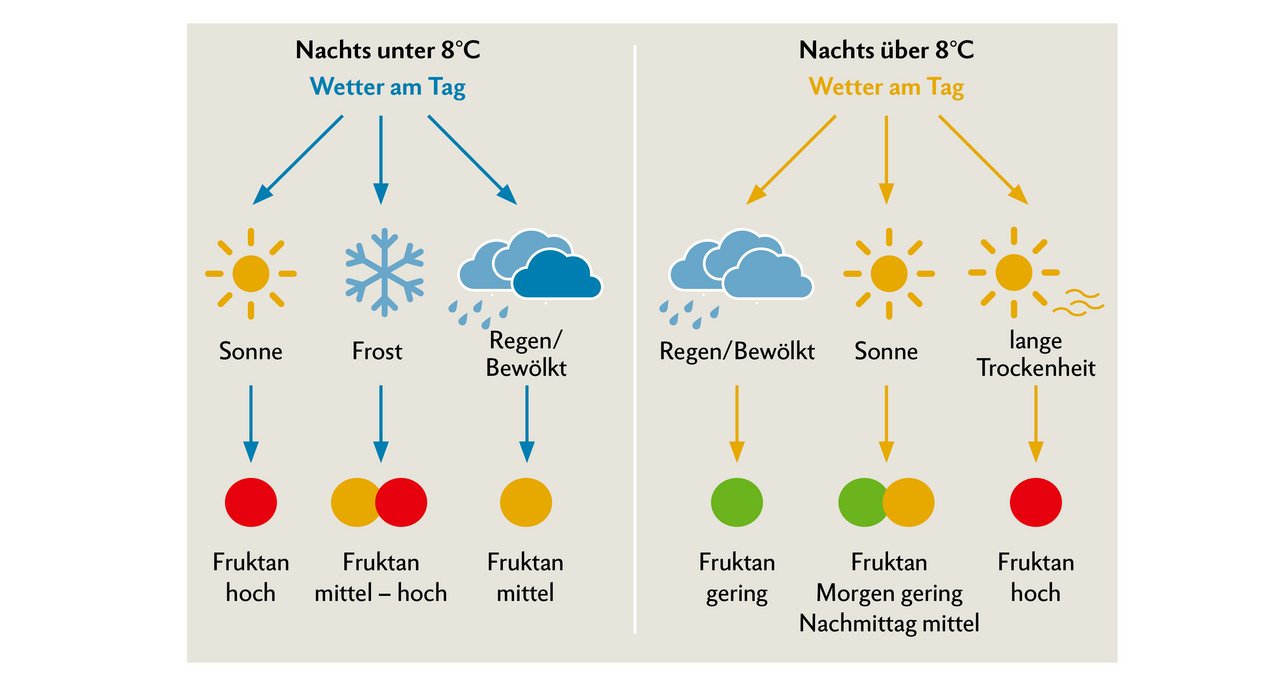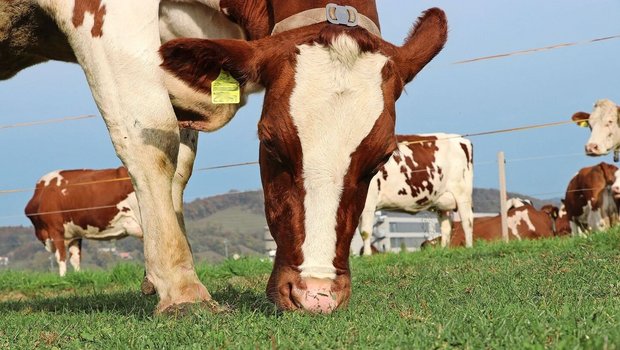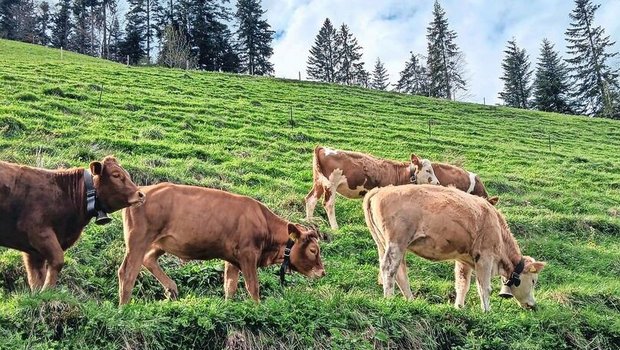1. Die Weide nicht rasieren … Horstgräser speichern ihre Nährstoffe in den Halmen. Sie werden geschwächt, wenn man sie zu tief einwintert. Ausserdem fördert ein tiefer Schnitt Tiefwurzler wie Blacken, Kriechender Hahnenfuss und das Gemeine Rispengras. Bei einer zu tiefen Nutzung des Bestandes ist die Gefahr hoch, dass das Futter verschmutzt. Der Grasbestand sollte nach der letzten Nutzung noch leicht nachwachsen…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.