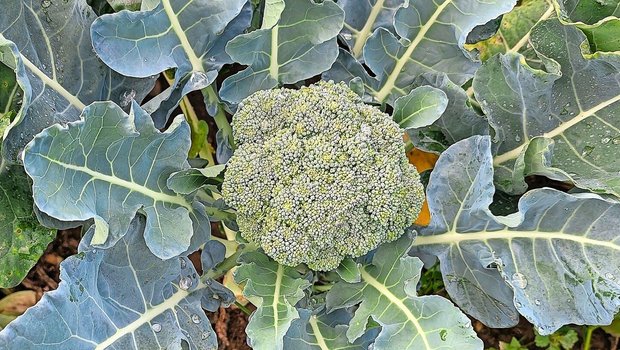Kurz & bündig - Weidegang fördert die Bildung von Seitentrieben und damit einer dichten Grasnarbe. - Je grösser die Tierbestände, desto weniger wird geweidet und desto anfälliger wird die Grasnarbe für Trittschäden. - Kühe mit hungrige, Magen auf die Weide lassen, damit sie gleich mit der Futteraufnahme beginnen. - Mehrere Weideeingänge entlasten den Boden. Kühe nie auf der Weide warten lassen. - Kühe nicht über…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 7 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.