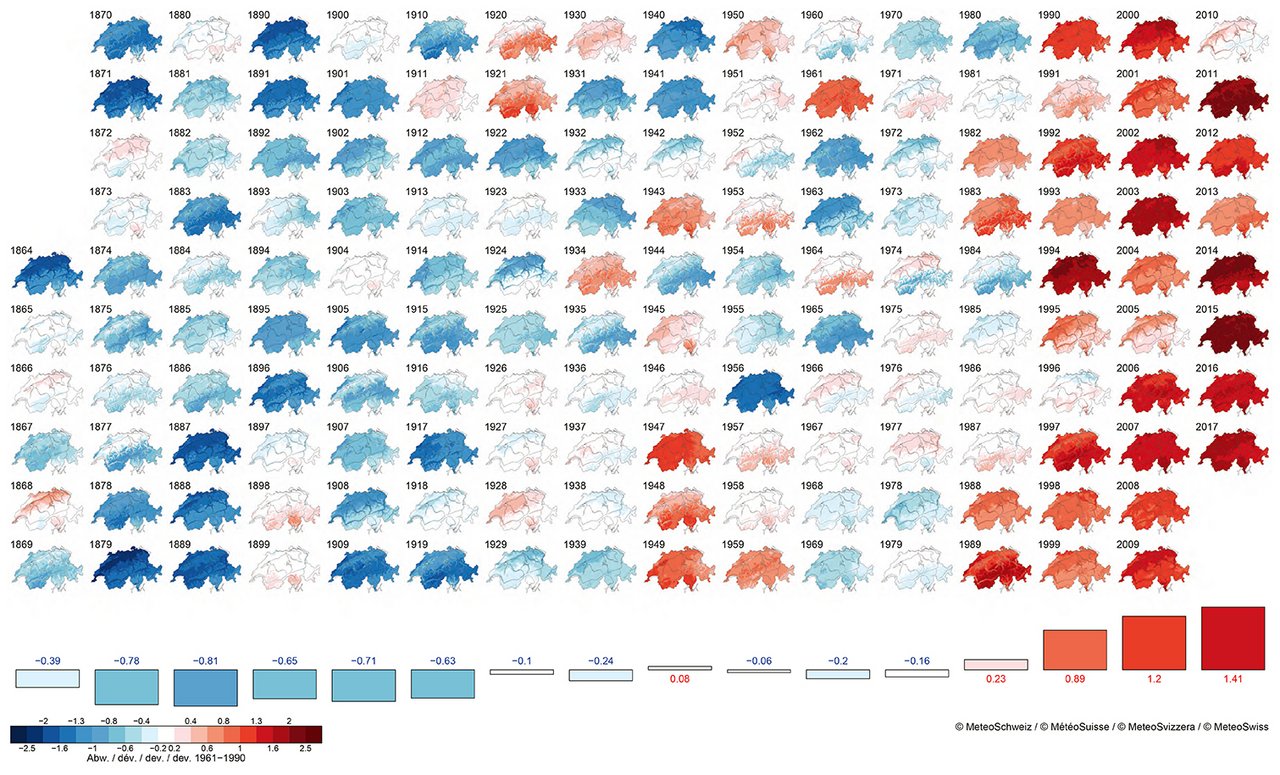Bastien Girod und Stefan Mutzner sind sich einig: Der Vorschlag zum neuen CO2-Gesetz löst keine (Klima-)Probleme. Girod ist Nationalrat der Grünen Partei Schweiz, Mutzner Geschäftsführer der Genossenschaft Ökostrom Schweiz. «Die Reduktion der Treibhausgase geht viel zu langsam voran», sagt Girod. Mutzner findet es «unglaublich und unverständlich, dass sich der Nationalrat nicht auf eine griffige Version des Gesetzes…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.