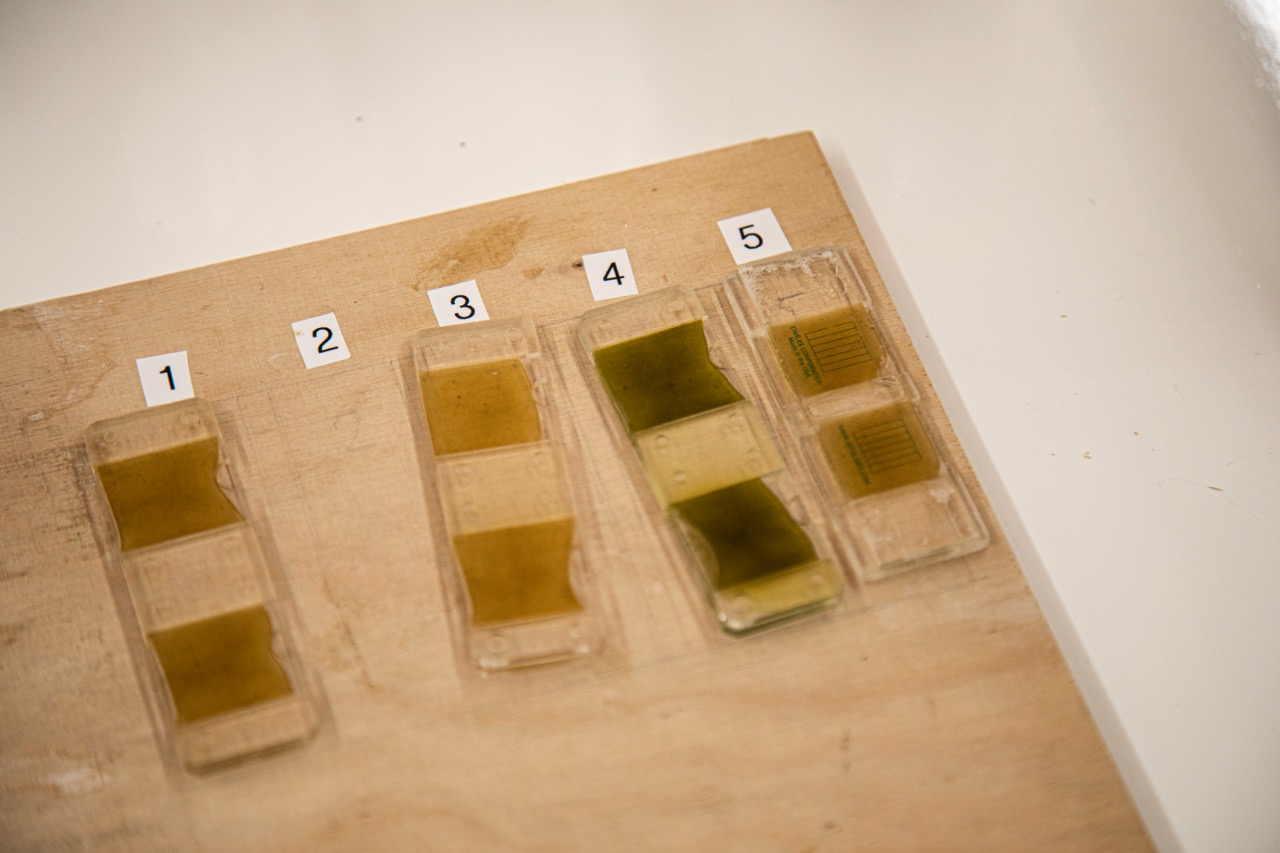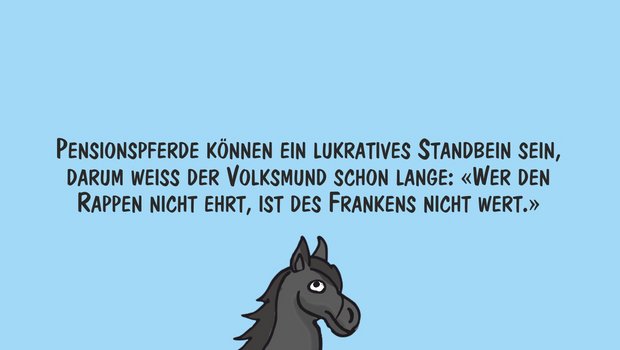Kurz & bündig - Wer die Pferdeäpfel von der Weide absammelt, dessen Pferde haben tendenziell einen geringeren Verwurmungs-Grad. - Nur 10 bis 20 Prozent der Pferde sprechen auf ein gutes Weide-Management an. - Es gibt Pferde, die muss man nie entwurmen. Und es gibt Pferde, die stecken sich immer an und müssen immer entwurmt werden. - Anderhubs lassen die Pferdeäpfel auf der Weide liegen, striegeln diese aber bei…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.