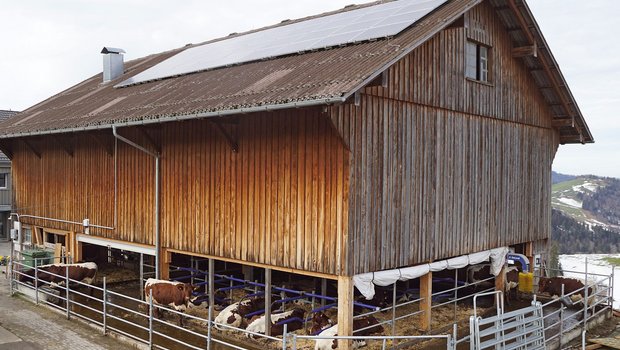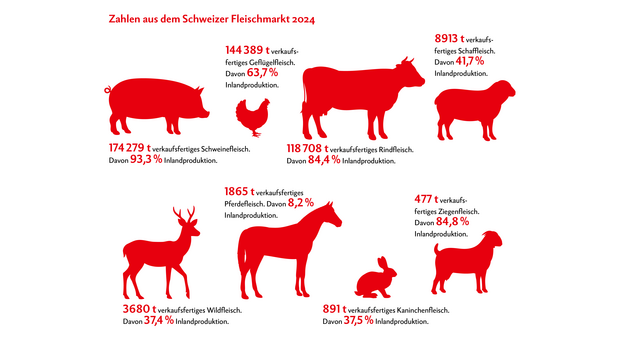Kurz & bündig - Kompostställe verwenden Einstreu-Materialien, die verrotten. - Der Kompost bietet eine weiche und im Winter warme Liegefläche. - Der Kompost muss täglich gelockert werden, damit Luft in das Material gelangt und der Kompost nicht vernässt. - Die Kühe bleiben sauber. Das dauernde Lockern des Bodens zerstört Fliegenlarven. - Ein grosses Stallvolumen und offene Wände fördern den Luftaustausch und damit…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 9 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.