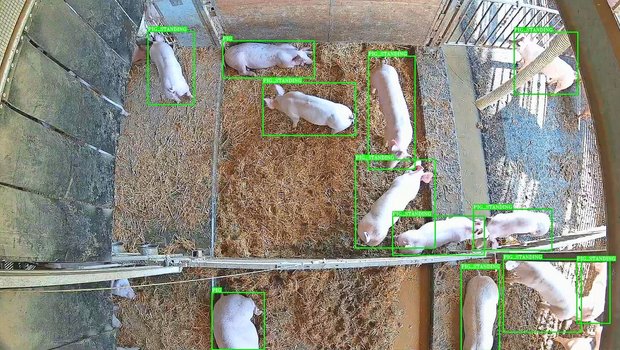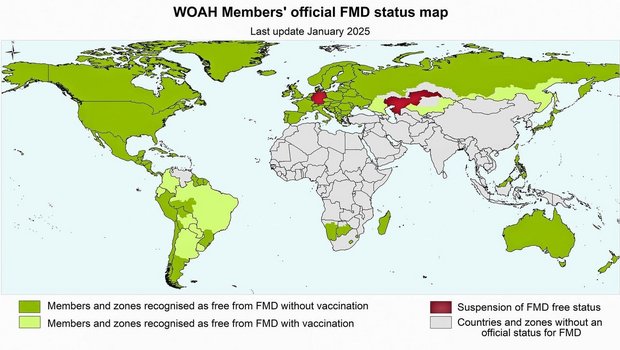Kurz & bündig - Benno Fleischli füttert seine Mastschweine in drei Phasen. - Er kauft zwei Futter zu, ein Vormast- und ein Ausmastfutter. Für die Mittelmast-Phase mischt er die beiden Futter zu einer dritten Rezeptur. - Frühere Investitionen in die Infrastruktur ermöglichten eine relativ einfache Umstellung der Fütterung: Gelagert ist das Futter in vier Silos, verteilt wird es flüssig über eine Ringleitung. Ein…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.