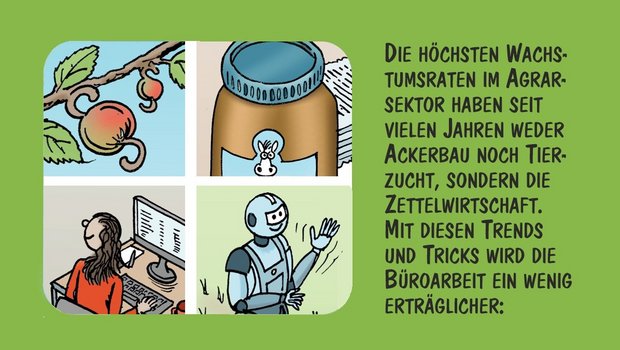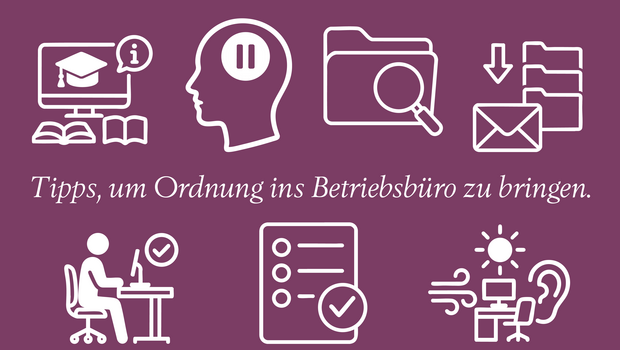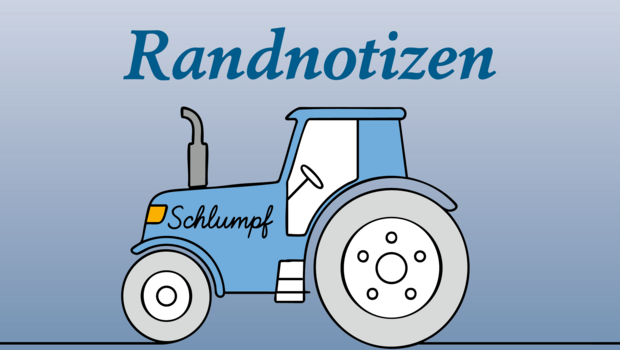Kurz & bündig
- Asbestfasern dringen beim Einatmen in die Lunge ein und können Jahre später schwere Krankheiten auslösen.
- Asbest steckt in Tausenden von Baumaterialien.
- Deshalb ist beim Umbau von jedem Gebäude, das vor 1990 erbaut wurde, Vorsicht geboten.
In der Wellfaserplatte, im Fensterkitt, in der Blumenkiste und der Elektroverteilung: Asbest war einst die Wunderfaser und versteckt sich bis heute in Tausenden von Baumaterialien. Asbest ist hitze- und säurebeständig, mechanisch strapazierfähig und lässt sich gut mit Textilien verweben.
Die Fasern sind jedoch so lang und dünn, dass sie beim Einatmen in die Lunge gelangen und dort schwere Krankheiten wie Asbestose, Lungenkrebs oder Tumore im Bereich des Bauch- oder Brustfells auslösen können. Vom Einatmen der Asbestfaser bis zum Ausbrechen der Krankheit können zwischen 15 und 40 Jahre vergehen.
In der Schweiz ist die Verwendung von Asbest seit 1990 verboten. Deshalb ergeben Modellrechnungen für Berufskrankheiten, dass das Maximum der Tumorerkrankungen erst etwa 2030 erreicht wird.
Natürlich steckt Asbest auch in den Baumaterialien von Landwirtschaftsbetrieben. Michael Frei von der Agroplanungen GmbH in Winistorf (SO) kennt das Thema: Vorsicht sei bei jedem Gebäude geboten, das vor 1990 gebaut wurde. Frei ist vor allem in Stallplanungen tätig. Besonders beim Bedachungsmaterial sei aber mit festgebundenem Asbest zu rechnen. Das stecke zum Beispiel in Wellfaser- oder Eternitplatten. Doch auch in alten Milchkammern mit Plättli steckt Asbest im Kleber, ebenso im Fensterkitt oder auf den Gehäusen von Elektroverteilungen.
[IMG 2]
«Vorsicht braucht es bei jedem Gebäude, das vor 1990 gebaut wurde.»
Michael Frei, Agroplanungen GmbH
Handwerker sind auf die Thematik sensibilisiert und kennen das Ampelmodell der Suva, das in den diversen Merkblättern verwendet wird:
- Grün bedeutet keine unmittelbare Gefährdung, wenn mit der notwendigen Vorsicht gearbeitet wird (z. B. Sichtkontrolle von grossformatigen Dachplatten).
- Orange bedeutet erhöhte Gefahr, es sind Schutzmassnahmen zu treffen (z. B. beim Demontieren von Faserzementplatten mit festgebundenem Asbest).
- Rot bedeutet grosse Gefährdung, solche Arbeiten dürfen nur von Asbestsanierungsfirmen ausgeführt werden, die von der Suva anerkannt sind (z. B. Sägen von grossformatigen Platten mit festgebundenem Asbest).
Die Suva hat nicht nur Merkblätter, sondern auf ihrer Website auch ein «virtuelles Asbesthaus». Darin lässt sich Zimmer für Zimmer entdecken, wo sich Asbestfasern verstecken könnten und welche Vorsichtsmassnahmen es braucht.
Bei Asbestverdacht – etwa bei Wellfaserplatten – braucht es beim Entfernen eine Schutzausrüstung. Bei diesen Arbeiten dürfen die Platten weder zersägt noch zerbrochen werden; es ist darauf zu achten, dass sie sorgfältig gelöst, vollständig vom Dach transportiert und fachgerecht entsorgt werden. Frei arbeitet mit erfahrenen Holzbauern und Dachdeckern zusammen, die die Entsorgung von asbesthaltigen Materialien bereits in die Offerte aufnehmen. Da die Entfernung länger dauert, ist die Arbeit auch etwas teurer.
Frei sagt, dass gewisse Kantone bereits bei der Baueingabe einen Schadstoffbericht verlangen. Da seien die Preisunterschiede gross, ein Vergleich lohne sich. Informationen gibt es auf der Website der Suva oder bei «Forum Asbest Schweiz».
Asbest mit künstlicher Intelligenz erkennen
Die Laboranalyse von Asbest erfolgt von Hand und ist teilweise mühselig. Bestrebungen, die Proben mithilfe von künstlicher Intelligenz auszuwerten, gibt es seit einigen Jahren. Die Suva hat eine KI-Software auf ihrem Elektronenmikroskop installiert. Seit April 2025 laufen erste Versuche damit, unterstützt von einem Informatik-Masterstudenten, der die Software laufend optimiert.
An der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Berlin befasst sich gar eine ganze Forschungsgruppe mit KI.
Patrick Steinle, Bereichsleiter Analytik bei der Suva in Luzern, weist aber darauf hin, dass es ausser den technischen Herausforderungen (Algorithmus, Geräte-Schnittstellen) nicht zuletzt die rechtlichen Fragestellungen zu klären seien. Dazu gehören Fragen wie: Wem gehören die Daten? Wo werden sie gespeichert?