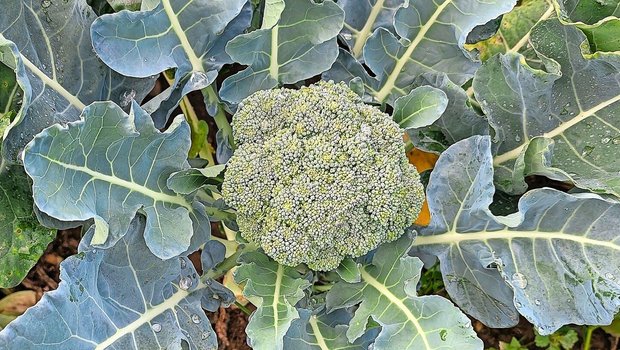Die Hysterie um Pestizide sei nur ein Furz im Wasserglas, das schreibt «die grüne»-Chefredaktor Jürg Vollmer im Heft 9/2023). Das ist angesichts der Faktenlage schlichtweg falsch: Pestizid-Rückstände werden mittlerweile in allen Ökosystemen gefunden – mit weitreichenden Folgen für Mensch, Tier und Umwelt. Allein in der Luft wurden mehr als 300 Stoffe nachgewiesen, die je nach Topografie der Landschaft 30 bis 300…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 3 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.