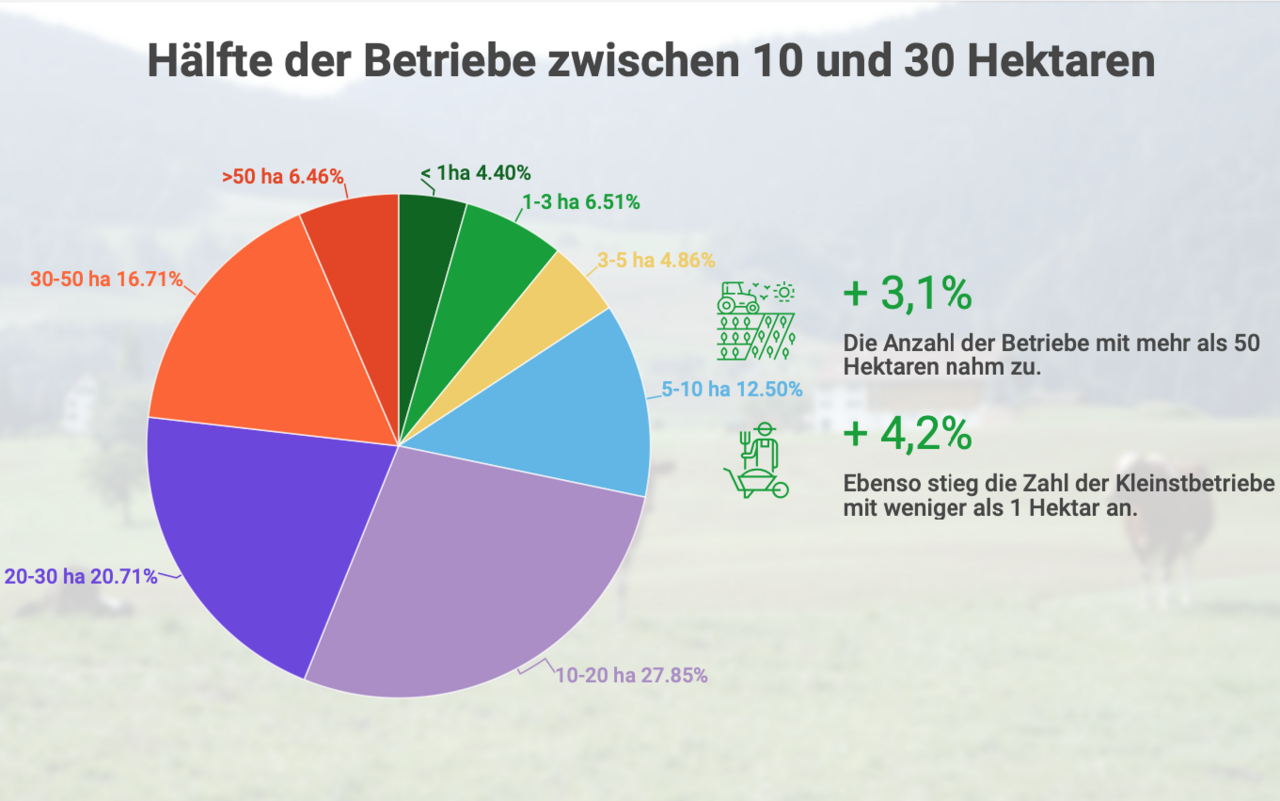Das Bundesamt für Landwirtschaft BLW publiziert seit dem Jahr 2000 einen jährlichen Agrarbericht, der die wichtigsten Entwicklungen in der Land- und Ernährungswirtschaft aufzeigt. Der Agrarbericht 2022 präsentiert auch eine Umfrage des Forschungsinstitutes gfs-zürich im Auftrag des BLW mit «Einschätzungen der Bevölkerung über die Schweizer Landwirtschaft» . BLW-Umfrage zu den «Einschätzungen der Bevölkerung über die…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.