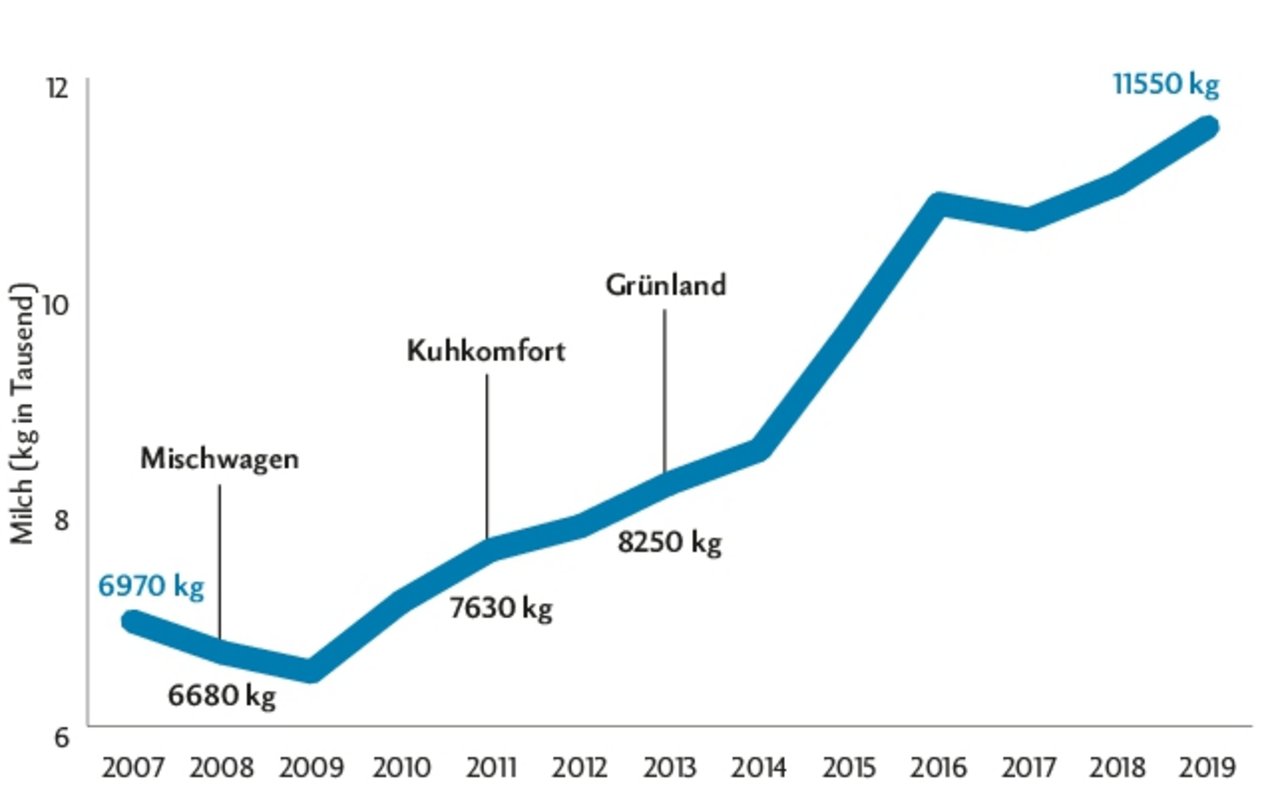Kurz & bündig - Intensiv genutztes Grünland erneuert sich nicht durch die Versamung der Gräser. - Abgestorbene Gräser, Spurschäden und Mäuseschäden hinterlassen Bestandeslücken. - Platzräuber wie Gemeines Rispengras füllen die Lücken und mindern Ertrag und Qualität. - Übersaaten verbessern den Ertrag und die Qualität des Grünlands. - Dichte Grasnarben sind trag-fähiger und bringen sauberes Futter. Ist eine Wiese…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.