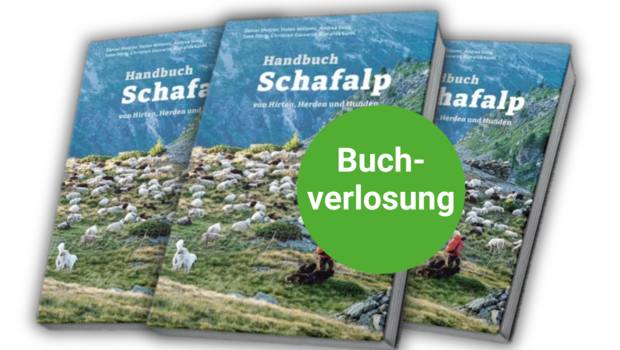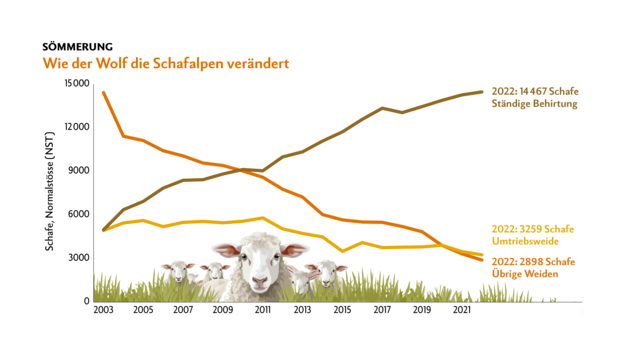Kurz & bündig - Urs Maier melkt 600 Schafe zwei Mal am Tag mit einem 36er-Melkkarussell. - Dank des Melkkarussells dauert das Melken jeweils nur zwei Stunden. - Die Aufzucht der Lämmer benötigt viel Zeit und Geduld. - Der Betrieb produziert das ganze Jahr über Milch. - Futtermischer und Futterbänder legen immer frisches Futter vor. Schafe hatten Urs Maier schon als Kind fasziniert. Mit 21 Jahren übernahm er den…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.
Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.
Haben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.