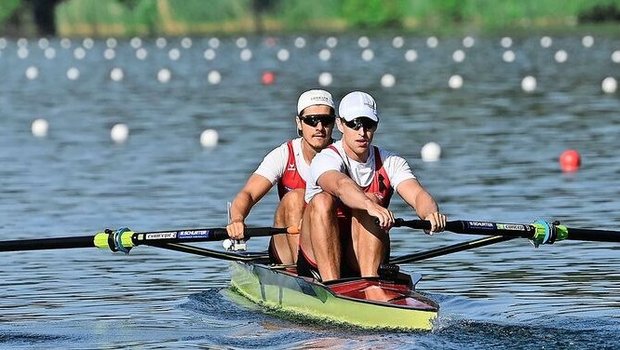Was soll – oder darf – künftig auf Schweizer Tellern landen? Das ist eine hoch-agrarpolitische Frage und dringt zugleich aus Sicht vieler tief in die Privatsphäre der Schweizer Bürger(innen) ein. Kein Wunder, dass die Ernährungs-Initiative polarisiert.
An Ideen für die Ernährung der Zukunft mangelt es nicht. Franziska Herren und ihre Unterstützer beziehen sich auf den Selbstversorgungsgrad, der auf 70 % steigen soll. Erreichen wollen sie dieses Ziel durch die Förderung der Produktion und des Konsums pflanzlicher Lebensmittel und die Reduktion von Food Waste. Die Schweiz habe genug Ackerböden, um sich zu 100 % selbst zu versorgen, heisst es im Argumentarium der Initianten. Sie beziehen sich dabei auf die raumplanerisch gesicherten Fruchtfolgeflächen (FFF) von schweizweit mindestens 438 460 ha, mit denen sich gemäss Bund in Notlagen ein Kalorienbedarf von 2340 kcal pro Person und Tag decken liessen. FFF machen heute knapp 31 % der ganzen Landwirtschaftsfläche der Schweiz aus und umfassen Äcker, Kunstwiesen sowie ackerfähige Naturwiesen.
Grössere Veränderungen bei der Hofübergabe
Diese ackerfähigen Naturwiesen – und vor allem Mais und Futtergetreide – stehen im Zentrum der Diskussionen über Tierbestände und Fleischkonsum. Seine Haltung dazu erläutert der Bundesrat in seinem Bericht zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik: Es brauche eine verstärkte Ausrichtung der Produktion auf die Standortbedingungen. «Auf nationaler Ebene bedeutet dies, dass die knappe Ackerfläche verstärkt für den Anbau von Kulturen zur direkten menschlichen Ernährung genutzt wird und die Tierhaltung stärker an die naturräumlichen Voraussetzungen bezüglich inländischem Futterproduktionspotenzial des Graslands auszurichten.» Die Veränderungen sollen synchron mit der Anpassung der Ernährungsmuster erfolgen. Der Bundesrat will die Sozialverträglichkeit des Wandels sicherstellen, indem das agrarpolitische Instrumentarium weiterentwickelt wird. Grössere strukturelle Veränderungen auf Ebene Betrieb sollen idealerweise zum Zeitpunkt der Hofübergabe erfolgen. Das passt dazu, dass in den nächsten Jahren viele Betriebsleiter pensioniert werden.
Standortgerecht heisst also das Zauberwort. Und wenn sich eine solche Produktion dann auch für die Landwirt(innen) lohnt, ist alles in Butter. Doch wie bringt man es dem Konsumenten bei? Denn ohne passende Nachfrage wird unrentabel auf Halde produziert.
Die Lebensmittelpyramide schmackhaft machen
Bildung, Sensibilisierung und Kostenwahrheit lautet die Antwort des Bundesrats. Er will den Schweizer(innen) auf diese Weise die Lebensmittelpyramide schmackhaft machen. Die Pyramide passe zu ihren Forderungen, findet das Komitee der Ernährungs-Initiative. Der Bund soll gemäss Initiativtext «insbesondere Massnahmen zur Förderung einer vermehrt auf pflanzlichen Lebensmitteln basierenden Ernährungsweise und einer darauf ausgerichteten Land- und Ernährungswirtschaft» treffen. Mehr ins Detail geht die Initiative nicht, es handelt sich schliesslich um Grundlagen für die Bundesverfassung. Doch eigentlich ist das nicht schlecht kompatibel mit dem, was der Bundesrat anpeilt.
Und doch empfiehlt er die Ernährungs-Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Oder aber, genau deshalb: Er macht klar, dass es seiner Meinung nach in diese Richtung gehen soll. Aber in einem anderen Zeithorizont. Es soll nicht 10 Jahre dauern, das Ernährungssystem umzukrempeln, sondern der Wandel soll bis 2050 geschafft sein. Als erster Schritt dahin laufen die Arbeiten zur AP 30 +.
Alles eine Frage des Masses
Kommt also der «Vegan-Zwang», mit dem die Gegner vor der Ernährungs-Initiative warnen, im Endeffekt aus Bundesbern? Wenn man die Berichte, Strategien und Zukunftsbilder studiert, ist die Antwort ein klares Nein. Und auch Franziska Herren verlangt nicht die Abschaffung der Tierhaltung. Es ist eine Frage des Masses. Und auch eingefleischten Veganern muss klar sein, dass sich nicht jede Fläche ackerbaulich nutzen lässt. Kunstwiesen tun überdies dem Boden gut und liefern sinnvollerweise Futter. Deswegen muss aber nicht jeder und jede Fleisch auf seinen oder ihren Teller laden oder Kuhmilch in den Kaffee schütten. Die einen mehr, die anderen weniger, manche gar nicht – es verträgt auf Seite Konsum dieselbe Diversität wie in der Produktion. Das eine standortgerecht, das andere nach Vorlieben und beides immer im gesunden Mass.
Die Frage bleibt, wie der Wandel zu erreichen ist. Eine bis ins Detail schlüssige und konkrete Antwort hat bisher niemand. Knackpunkt ist oft das Geld, denn Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben und Konsumenten die Produkte bezahlen können.
Die Frage ist komplex und die Antwort muss es auch sein. Doch damit gewinnt man keinen Abstimmungs-Kampf, weder für noch gegen die Ernährungs-Initiative. Daher dürfte es allerlei verkürzte Aussagen und kaum eingebettete Schlagworte geben. Spätestens danach muss die Diskussion wieder sachlich geführt werden. Denn wir brauchen eine Antwort – und zwar bald.